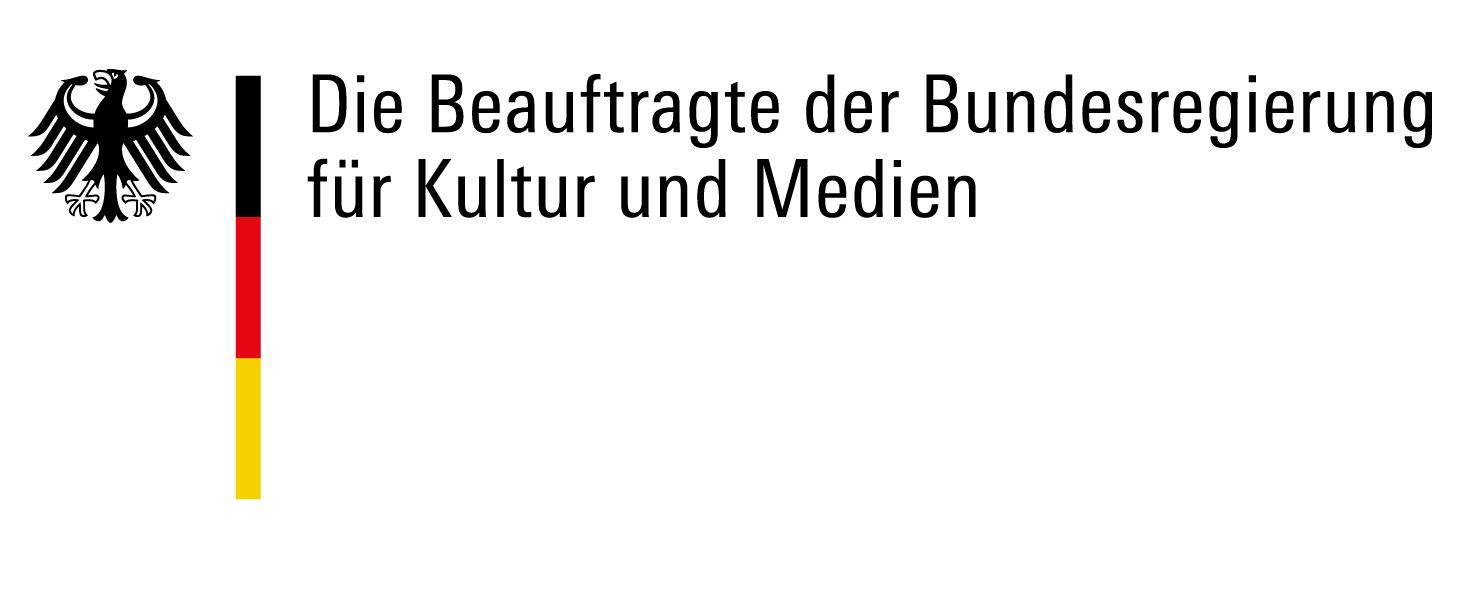MUT
In Deutschland leben ca.5 Millionen Frauen mit einer Behinderung, das entspricht etwa 12% der weiblichen Bevölkerung. Um es von dieser schwachen Position aus, die zu Grenzüberschreitungen und unterschwelligen Machtspielchen auf meine Kosten regelrecht einlädt, mit der Gesellschaft aufnehmen zu können, braucht es ein hohes Maß an Selbsicherheit und mentaler Stärke. Fast täglich muss ich mich darin üben, mein aufgebrachtes Nervensystem zu beruhigen und Ungerechtigkeiten nicht persönlich zu nehmen. Gelingt mir dies nicht, gebe ich meine Macht ab und mache mich zum Opfer einer komplexbeladenen Gesellschaft, die mich zu ihrer narzisstischen Befriedigung missbrauchen möchte. Ich lasse dann zu, dass sie meinen Wert bestimmt.
Stattdessen behalte ich die Macht, indem ich mir klar mache, dass alle Menschen in den Augen der Vögel behindert sind, weil sie nicht fliegen können. Damit ist also Behinderung relativ und liegt im Auge des Betrachters. Ich kann mich also frei entscheiden, wie ich mich sehen möchte.
Mangelhaft und behindert oder hingegen vollkommen und frei.
Obwohl ich mich bereits vor mehr als einem Jahrzehnt bewusst für meine Kunst und damit auch für meine Freiheit entschieden habe, triggern mich Ungerechtigkeiten im Alltag und lassen mich teilweise ohnmächtig reagieren. In einem solchen akuten Zustand helfen mir dann auch keine Bewustseinstechniken oder Atemübungen mehr aus dem Yoga, um mein ausfgebrachtes Nervensystem wieder zu beruhigen und wieder, Herrin der Lage zu werden.
Jedoch kann ich mich vorbereiten, damit es gar nicht erst zu einem solchen kompletten Kontrollverlust kommt und ich die Klarsicht möglichst lange behalte. Dazu habe ich mir ein persönliches Set mit verschiedenen Tools angelegt, wie ich mich im Alltag herausfordere und so wachsen lasse:
Zum Beispiel versuche ich meinen Alltag oft mit kleinen Mutproben zu spicken.
Die Mutproben sind dabei rein subjektiv, also ich muss dabei meine Ängste sehen, anerkennen und schließlich überwinden. Für eine schüchterne Person ist es beispielsweise bereits eine Mutprobe fremde Leute nach der Uhrzeit zu fragen, während dies als Mutprobe für kommunikativere Typen nicht funktioniert
In meinem Fall funktioniert das sehr gut, denn zeitweise bin ich sehr introvertiert und schüchtern und muss mich dann richtig zwingen aus meiner Muschel herauszukriechen. Wenn ich mich überwunden habe, öffne und so in den Austausch/ die Verbindung gehe, werde ich meist mit einem wohligen Gefühl belohnt. Ich habe mir dann gezeigt, dass ich mehr bin als mein Körper und die Kontrolle über mich habe. Negative Erfahrungen aus der Vergangenheit, die mich in solchen Triggermomenten zur emotionalen Überreaktion führen, konnte ich so laut C.G.Jung ein wenig überschreiben.
In Triggermomenten bleibt mir auch regelmäßig die Stimme weg, was mir so auch noch die Möglichkeit der verbalen Verteidigung nimmt. Mein Nervensystem ist dann im Überlebensmodus. Ich kann dann weder flüchten noch kämpfen. Meine innere Stimme schreit vor Wut, doch bleibt unerhört, denn ich kann sie nicht ausdrücken.
In Anlehnung daran beschloss ich mit meiner langjährigen Stimmbildungslehrerin Stefanie Sylla in einem Café mit Mikrofon alleine zu singen, während sie mich mit Gitarre begleitete. Dabei ging es nicht darum, einfach nur schön zu singen und Töne zu treffen, sondern ich wollte meiner Stimme und damit symbolisch all meinen Empfindungen und Emotionen Raum geben.
Ich war an diesem Tag auch sehr nervös und aufgeregt. Aber da wir eine gemütliche kleine Frauenrunde waren mit zwei, drei spielenden Kindern die alles auflockerten, war ich sehr in meiner Kraft und mir fiel das Stimmehalten leichter als gedacht. Jedoch war die Tür des Cafés offen und ich konnte die Energie vorbeilaufender Leute und die direkte Auswirkung auf meine Stimme spüren und auch hören. Ich wollte lediglich lernen dies zuzulassen ohne mit Scham darauf zu reagieren. Meine innere Stimme laut werden lassen. Ich wollte lernen, zu mir, meinem Körper und meiner Stimme zu stehen. Jede Facette davon sollte ohne Zensur Ausdruck finden.
Zudem war eine zweite kleine aktivistische Mutprobe für mich, meine Autobiografie auf dem Flohmarkt im Mauerpark zu verkaufen:
Ich musste dabei lernen Abstand zu nehmen und es nicht persönlich zu nehmen, wenn sich jemand eben nicht für meine Autobiografie und damit für mich und mein Leben interessierte.
So mancher nahm meine Autobiografie in die Hand, die meine ganze Liebe für das Leben ausdrückt, klappte das Buch zusammen und legte es wieder kommentarlos weg. Ein älterer Mann legte mein Buch sogar kopfschüttelnd weg und kommentierte dies mit „ Oh nee das ist mir jetzt zu schwer…..!“Direkt konnte ich spüren, dass ich sein Verhalten als abwertend empfand und mit Scham auf seine Ablehnung reagieren wollte. Dieses Muster kannte ich bereits. Ich riss mich zusammen, richtete mich auf, lächelte ihn an und wünschte ihm noch einen schönen Sonntag. Das Leben ist zu kurz, um es persönlich zu nehmen.

(illustration by Ivan Blazetic Sumski)
BRAIN OPERATION VOM 14.1.-29.2.2020
In meinem siebenwöchigen Selbsterforschungsprojekt namens „Brain operation“ wollte ich mehr über die heilsame Melodie des Geistes herausfinden, die das Gehirn spielt, wenn man in etwas „versunken“ist, wie Hermann Hesse den Zustand der Meditation oder der höchsten Konzentration nennt. Ich wusste, dass diese heilsame Melodie mein Gehirn verändern würde und ich so schließlich mein Bewegungs- und Ausdrucksvokabular erweitern könnte.
Welcher heilsame geistige Zustand ließ die Künstler körperlich performen?
Ich hatte bei diesem Selbsterforschungsprojekt die Unterstützung von acht kreativen Mitarbeitern. Diese Tänzer, Körpertherapeuten, Yogis oder Musiker inspirierten mich mit verschiedenen Techniken und Methoden, Körper und Geist in Einklang zu bringen, um schließlich das volle körperliche Potenzial entfalten zu können.
Dieser Prozess wurde in meinem Tagebuch festgehalten sowie mit Video-Aufnahmen von Yango Gonzalez dokumentiert. Dabei entstand ein Film, der zusammen mit meiner Performance am Ende des Projektes gezeigt wurde.
Meine solistische Performance, die ich am 29.2.2020 in den Uferstudios zeigte, repräsentierte meine innere und auch äußerliche Reise während des Projektes. Von innen nach außen, von leise zu laut, von Vorstellung zu Wirklichkeit…
Der Hintergrund und schließlich die Projektidee
Die, dem Projekt zugrunde liegende Idee der Körper-Geist-Beziehungsarbeit sehe ich schon lange als meine Lebensaufgabe an.
Mit 17 Jahren wurde bei mir die Friedreich-Ataxie, eine chronische Nervenerkrankung, diagnostiziert. Man hat mir gesagt, dass eine Heilung der Nerven unmöglich und der Krankheitsverlauf daher fortschreitend sei. Diese Unmöglichkeit der Nervenheilung konnte ich so nicht hinnehmen. Mein ganzes Leben hing davon ab, wie Körper und Geist über das Nervensystem miteinander kommunizierten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich nichts tuen konnte, um diese innere Kommunikation zu verbessern. Außerdem war wirklich nichts unmöglich.
Daher habe ich mich bemüht mehr Informationen über das Gehirn und seine Funktionsweise herauszufinden.
Laut wissenschaftlichen Untersuchungen sind die Nerven bislang irreparabel, aber dennoch wurde die Veränderbarkeit des Gehirns festgestellt. Damit sind Lernprozesse möglich.
Wenn ein Nerv beispielsweise durch einen Reiz regelmäßig angeregt wird, so ist er in der Lage mehr zuständiges Hirnareal, also mehr Gewebe zur Verfügung zu stellen. Neurowissenschaftler vergleichen dies mit einem sich vergrößernden Straßennetz oder mit Trampelpfaden, die immer fester eingetrampelt werden.
Seit ich erstmals von der Entdeckung der Neuroplastizität erfahren habe, wollte ich mir dieses Konzept im Alltag zunutze machen. Ich wollte gewissermaßen mein Gehirn dazu bringen, sich bestmöglich an den krankheitstypischen ”Defekt”im Kleinhirn, das für die Motorik zuständig war, anzupassen. Es sollte quasi mutieren und neue synaptische Verbindungen herstellen, um seine für die Motorik wichtigen Aufgaben wahrnehmen zu können, wie die Koordination oder die Feinabstimmung der Bewegung beispielsweise.
Zu dieser Zeit gabs noch eine andere Studie, die belegt hatte, dass eine gedanklich vorgestellte Bewegung, die gleichen messbaren Auswirkungen auf das Gehirn hat als eine tatsächlich ausgeführte Bewegung. Somit war ich in der Annahme bestätigt, dass der Geist die Materie beherrscht, und fing hochmotiviert mit täglichen Übungseinheiten zur „selbstgesteuerten Neuroplastizität“an. Damit wollte ich mein Gehirn, insbesondere das für die Bewegung zuständige Hirnareal, verändern. Doch auch mit Geduld und Kontinuität, stellte sich kein merklicher Erfolg ein. Es musste ein Fehler in meiner Anwendung liegen und diese so keinen echten Lernprozess für das Gehirn darstellen.
Täglich stellte ich mir vor, zu laufen. Ich sah dabei sogar eine saftig grüne Wiese, über die ich lief. Der Wind wehte leicht und der Himmel war blau. Ich trug ein buntes Sommerkleid und war barfuß. Doch diese gedankliche Vorstellung der Bewegung hatte keinen Einfluss auf den Körper. Das Nervensystem schien meine Vorstellung der Bewegung nicht zum Körper zu transportieren. Ich konnte die Bewegung sehen, nicht jedoch fühlen. Die Vorstellung der Bewegung blieb so bloßes Kopfkino. Meine starke Abspaltung zwischen Körper und Geist wurde mir bewusst, woran der gemeinsame Lernprozess gescheitert war.
Mein neuer Ansatz sollte die grüne Wiese und den Wind vernachlässigen und stattdessen den absoluten Fokus auf den Körper richten. Ich versuchte nun mit dem Körper selbst zu arbeiten und volle Bewusstheit in die Bewegung zu bringen, um das Gehirn zu neuen Nervenverbindungen anzuregen. Dabei entwickelte ich auch meine sogenannte „Bordering-Methode“, die bei einer Bewegung die komplette Muskelkette zurückverfolgt, um so eventuelle Blockaden lokalisieren und auflösen zu können. Die Auflösung erfolgt dabei durch den Versuch die Körpersprache zu lesen, sie zu deuten, zu decodieren. Diese „Bordering-Methode“ durfte ich auch im August 2019 in einer Künstlerresidenz von „making a difference“ weiterentwickeln. Durch diese Arbeit konnte ich die Kommunikation zwischen Körper und Geist stärken, sie transparenter machen. Jedoch konnte ich damit noch immer nicht diesen heilsamen Theta-Zustand, der das Gehirn verändert, erreichen.
Bei vielen künstlerischen Aktivitäten (Tanzen, Yoga, Singen, Trommeln, Malen, Meditieren) konnte ich jedoch fühlen, dass mein Geist eine solche heilsame Melodie für den ganzen Körper spielte. Ich wusste, dass dies die Melodie des Geistes ist, die das Gehirn spielt, wenn es sich verändert.
Die gleiche Melodie, die Künstler spielen, wenn sie ihre Kunst betreiben, oder Musiker oder Yogis, Sportler oder einfach jemand, der meditiert. Ich wusste, dass diese heilsame Melodie des Geistes etwas mit höchster Konzentration zu tun hat. Mit dieser Motivation hatte ich die Projektidee von Brain Operation. Ich wollte mehr von dem heilsamen Zustand herausfinden, der die Künstler performen ließ.

Die Arbeit während des Projekts
So fand ich heraus, dass beispielsweise die Tänzer über den Körper, den Geist in den Theta-Zustand versetzten, Yogis über den Geist an den Körper gelangten und die Musiker hingegen die Energie als eigenes Wesen wahrnahmen, das in ihrem Körper pulsierte.
Alle hatten jedoch eine Sache gemeinsam-die volle Hingabe!
FORSCHUNG UND PERFORMANCE IN DER EINZELARBEIT
Nach 6 Wochen Inspiration, verblieb nun eine Woche, die ich der Einzelarbeit widmen wollte. Gerne wollte ich nun mehr über den Lagesinn, also die Tiefensensibilität herausfinden. Die Tiefensensibilität beschrieb unter anderem das eigene körperliche Raumgefühl ohne visuelle Kontrolle (Wo im Raum befinden sich meine Körperteile/ meine Gelenke usw.?) Außerdem wollte ich mit der Meditation gerne endlich tiefer gehen als meine täglichen 15 Minuten. Ich wusste, dass die Meditation ein kostbarer Schatz war für meine Gehirnarbeit, die diese um eine Dimension erweitern könnte. Laut wissenschaftlichen Untersuchungen versetzte die Meditation das Gehirn in den Theta-Zustand und schaffte es so, alle Programme zu „resetten“.
Zudem wollte ich mich in dieser Woche mit der Atmung beschäftigen, deren Wichtigkeit mir in meinem Projekt erneut aufgezeigt worden war. In meiner Yogapraxis hatte ich jahrelang Pranayama, das eigentliche Herzstück des Yoga, stark vernachlässigt bis komplett unter den Tisch fallen lassen. Ich war schon glücklich, wenn ich die körperlichen Übungen mit Atmung synchronisierte. Um mich nur auf das Atmen zu konzentrieren, war ich zu schnell gelangweilt und zu ungeduldig. Sogar in meinem Unterricht. Ich wusste aber um die Bedeutung der Atmung für Körper und Geist. Ich wusste, dass beide über die Atmung miteinander kommunizierten und ich die große Kunst der Geduld so erlernen konnte.
Ich hatte also große Pläne für die 5 Arbeitstage, die ich für jeweils 5h in einem gemieteten Tanzstudio verbrachte. Am sechsten Tag, ein Samstag, sollte meine Performance nachmittags stattfinden, auf die ich mich schließlich ja auch noch vorbereiten musste. Zwar wusste ich den groben Rahmen und wollte teilweise auch frei improvisieren, um wirklich im Moment zu sein, jedoch wollte ich mir zumindest ein Repertoire zulegen, um mich daraus frei bedienen zu können. Außerdem war ich noch immer unentschlossen, was die Musik anging und wollte mich nun so früh wie möglich festlegen.
Der erste Arbeitstag sollte meine Forschungen zu dem Thema Tiefensensibilität beinhalten. Leider gab es an diesem Tag sehr viele organisatorische Dinge, die es zu klären galt. Die Bedienung der Musikanlage beispielsweise wurde uns erklärt. Kurze Zeit später fielen die Lautsprecher aus und wir mussten wieder jemand finden, der das in Ordnung brachte, so dass ich meine Arbeit fortführen konnte.
Nach einem kurzen Aufwärmen performte ich dann schließlich auf die verschiedene mitgebrachte Musik in der Hoffnung einen klaren Impuls zu fühlen, der mir dann die Entscheidung abnehmen würde. Doch leider konnte ich keinen klaren Entschluss fassen. Alle Musikstücke rückten meine Performance in ein völlig anderes Licht und inspirierten mich zu neuen Bewegungen. Bei Klassik konnte ich entspannen und spürte, dass ich im Augenblick war. Dennoch fühlte ich mich dabei irgendwie zu grazilen Ballettmoves gezwungen, die mich dann in meinem Ausdruck wieder einschränken würden. Was ich zu sagen hatte, war nicht nur elegant und schön. Geschweige denn perfekt.
Die experimentelle Musik, die ich mitgebracht hatte, hatte zwar Ecken und Kanten, die meine Perfomance akzentuierte, jedoch war sie alles in allem als Projektionsfläche für mein gesammeltes Material, das ich verarbeiten wollte, nicht neutral genug. Ich beschloss die Entscheidung, was die Musik anging, zu vertagen.
Nach der Mittagspause beschloss ich, die mir noch verbleibenden zwei Stunden zur Erkundung des Bodens zu nutzen. Ich rollerte zunächst das ganze Studio ab, um den Raum wahrzunehmen und auch zu würdigen. Sodann blieb ich stehen und stieg auf den Boden herunter. Nun hatte ich erstmals wirklich engen Kontakt mit dem Boden. Er schien meiner Belastung sanft nachzgeben und keinen Widerstand zu leisten Ich spürte seine liebevolle Unterstützung bei meiner Arbeit. Ich genoss es, mich auf ihm zu wälzen, zu robben, entlangzuhangeln und Krabbelversuche zu starten. Er schien mich zu tragen, anstatt mich abzustoßen. Dabei fühlte ich die scheinbar unendliche Weite des Bodens, der mich als einen Teil von sich auf ihm spielen ließ. Er umhüllte mich mit einem wärmenden Mantel und gab mir dabei ein Gefühl der Geborgenheit und des Friedens. Erschöpft blieb ich nach einer Weile mitten im Raum liegen. Mit weit ausgebreiteten Armen und Beinen lag ich auf dem Rücken. Ich starrte zur Decke, während sich mein aufgebrachtes System und mein Atem sichtlich beruhigten. Es regnete draußen. Der Regen prasselte an das Dachfenster an der Decke. Die Akkustik war perfekt. Der Klang war so natürlich, erfrischend, nährend und zugleich inspirierend. Vor meinem geistigen Auge, sah ich mich dazu tanzen. Ich schloss die Augen und fühlte tiefe Entspannung und Erdung bis in die kleinen Zehen. Ich versuchte, die Erdenergie durch meine Ferse des linken Fußes einzuatmen, während ich sie mit der Ausatmung wieder zurück in die Erde fallen ließ. Vor meinem geistigen Auge sah ich dabei, wie ich mit der Einatmung die Erdenergie durch meine linke Ferse und durch mein ganzes linkes Bein bis zum Körperzentrum zog und mit der Ausatmung die „verbrauchte Energie“ wieder durch mein rechtes Bein zurück in den Boden fallen ließ. Nach fünf Wiederholungen wechselte ich die Richtung. Als plötzlich mein Assistent vor mir stand wie verabredet, bemerkte ich, wie schnell die Zeit vergangen war. Mit Hilfe meines Assistenten setzte ich mich zurück in den Rolli. Nachdem wir die Knieschoner ausgezogen, warme Hosen sowie Mantel angezogen und auch die Schuhe gewechselt hatten, standen schon Tänzer vor mir, die das Studio für die Folgezeit gemietet hatten. Ich setzte mich noch zurück in meinen E-Rolli und ließ stattdessen meinen Tanzrolli bis zum nächsten Morgen im Studio.
Auf der fast einstündigen Heimfahrt in der S-Bahn spürte ich dann wieder Ungeduld und Unzufriedenheit, wo eben noch Entspannung und Vertrauen gewesen war. Der erste Arbeitstag war reich, bunt und schön gewesen, jedoch hatte er mir keine Ergebnisse geliefert, die mich in meiner Gelassenheit bestätigt hätten. Ich dachte an die noch immer nicht feststehende Musik für meine Performance, als auch an die Erforschung des Lagesinns und die Vertiefung meiner Atmung sowie die Ausarbeitung meiner Performance. All das war eigentlich für heute geplant gewesen. Zumindest hatte ich damit solide beginnen wollen. Stattdessen wusste ich nun, wie man die Musikanlage und die Lautsprecher bedient, wie man die Fenster öffnen und schließen kann, wo das Mittagessen gut und günstig ist und – achja – ich hatte dem Boden „Hallo“ gesagt. So war es immer gewesen. Meine Pläne, meine verkopfte Vorstellung der Wirklichkeit und der tatsächliche Moment, die Realität, hatten nicht viel gemeinsam. Meine sorgfältigst ausgearbeiteten Pläne, die vor Ideen und Intension nur so strotzen, zerplatzten wie Seifenblasen bei der Kollision mit der Realität. Mein Kopf sollte lernen, ein paar Gänge runterzuschalten, zu entschleunigen und nichts zu erwarten. Ich sollte damit rechnen, meinen Weg im Schneckentempo zu gehen, anstatt immer wieder aufs Neue enttäuscht zu sein. Man nannte dieses die eigenen sturen (Steinbock-)Hörner mit der Realität reiben und abstoßen auch „LERNEN“. Mein Geist sollte es auch wertschätzen, dass ich nun auch über die praktisch wertvollen Dinge Bescheid wusste, wie die Bedienung der Musikanlage usw. und dass ich mich eins mit dem Boden gefühlt hatte. Ich wollte doch sowieso mehr fühlen als denken. Weniger planen und mehr Raum für das bunte reiche Leben und seine Überraschungen schaffen. Mein Kopf sollte Flexibilität und Bescheidenheit erlernen, anstatt sich stur gegen die Wand durchzusetzen. Koste es, was es wolle! Die eigene Vitalität? Über die eigene Leiche? Nein, ganz bestimmt nicht! Lieber vital und in Harmonie, als ein ferngesteuerter, halbtoter Zombie, der abgehetzt seine To-do-Liste abhakt. Dafür stand doch mein Projekt „Brain Operation“. Ich wollte doch an einer intakten Körper-Geist-Beziehung arbeiten. Um mir zu zeigen, dass ich es ernst meinte, beschloss ich, nun morgen nur an der Performance zu arbeiten. Ich wollte die Musik aussuchen, mir den genauen tänzerischen Ablauf überlegen sowie mir schließlich auch über das Ende der Performance klar werden. Sollte die Performance in ein Mantrasingen meinerseits münden oder besser in eine geführte Meditation? Ich wollte mich dabei herausfordern, jedoch nicht hingegen überfordern und traumatisieren. Was ich dabei suchen wollte, war also mal wieder der goldene Mittelweg, der mehr als alle meine bereits vorhandenen Fähigkeiten abverlangen, sondern mich hingegen über mich hinauswachsen lassen sollte. Hochmotiviert beschloss ich, den Tag morgen mit einer kleinen Meditation zu beginnen, sowie mich bei einer buddhistischen Rezitation geistig auszurichten. Bei der Performance wollte ich dann auch die Atmung stets im Blick behalten. Das erschien mir als fairer Kompromiss zwischen meinem ungeduldigen Kopf und der Realität mit ihren eigenen Zeitgesetzen, durchaus machbar. Zufrieden setzte ich meine Kopfhörer auf und genoss meinen Feierabend, der mir nun wohlverdient vorkam. War alles Auslegungssache und verhandelbar gewesen.
Am nächsten Tag erreichte ich zusammen mit meiner Assistenz pünktlich das Studio, um es für die fünf gemieteten Stunden komplett nutzen zu können. Dieses Mal hatte ich sogar bereits daheim zu Mittag gegessen und nun eine Banane sowie ein Brot dabei für eine kleine Pause. So wollte ich etwas Zeit sparen, um die fünf Stunden fokussiert bei der Sache bleiben zu können.
Pünktlich fuhr ich nun das Studio ab und blieb intuitiv an einer Stelle an der Wand. Dann stellte ich mich nun im Roll mit dem Rücken gegen die Wand. Nachdem ich die Augen geschlossen und tief ausgeatmet hatte, begann ich mich in mich zurückzuziehen. Dabei beobachtete ich zunächst mein Innenleben. Ich sah dabei meine inneren Organe. Wenn ich mich stark konzentrierte, so konnte ich sogar die Geräusche meines Innenlebens wahrnehmen. Ich hörte dann Blut und Wasser rauschen, einströmende Luft sowie das Kontrahieren und Ausbreiten des Zwerchfells und manchmal sogar die Zellatmung und die damit verbundenen Stoffwechselvorgänge. Das Geräusch und das Gefühl, das von der Transformation von Sauerstoff in Energie ausgelöst wurde, konnte ich regelrecht bezeugen. Ich musste dazu nur meiner inneren Stimme voll vertrauen und ihr genau zuhören, um sie in ihrer leisen Feinheit wahrnehmen zu können. Dazu hörte ich einen alles dominierenden Rhythmus, der vom Herz in meiner Brust ausging. Mein Herz schien den Takt für alle Prozesse in diesem kleinen Minikosmos vorzugeben. Ähnlich wie das Geschehen im Außen im Rhythmus und Takt der Sonne stattfand, so war dies im Inneren das pumpende Herz, das gleich der tickenden Uhr jeden Prozess veranlasste und beendete. Das Herz schien alle körperinternen Abläufe zu beeinflussen. Wie die Sonne die wichtigste Energiequelle der Erde war, so schien das Herz die wichtigste Energiequelle für fast alle im Körperinneren ablaufenden Vorgänge zu sein. Ich stellte mir vor, dass alle Stoffwechselvorgänge durch die umgewandelte Herzensenergie möglich waren und dass, das Herz im Inneren so die Entsprechung der Sonne im Außen war. Direkt konnte ich spüren, wie mein Herz mit dieser Vorstellung höherschlug und dabei meinen ganzen Körper energetisierte.
Ich fragte mich, was denn die körperinnere Entsprechung für den Mond war, die bestimmt sehr viel Einfluss auf die Flüssigkeiten im Körper haben würde. Die Vorstellung, dass alles eins und nur in andere Maßstäbe übersetzt war, gefiel mir. Es war ganzheitlich und bedeutete, dass, wenn ich im Außen Konflikte löste und Muster durchbrach, ich mich im Inneren heilen konnte und umgekehrt. Alles war alles. Es gab keine Trennung.
Immer wieder schienen mich meine Gedanken davonzutragen. Wie ein kleines Vögelchen ließ ich mich von Gedanken, die meine Klarsicht trübten, forttragen. Sie betonierten künstlich einen Weg in die Zukunft, während sie den gegenwärtigen Augenblick lebendig begruben. Mit einem tiefen Seufzer, versuchte ich immer wieder meine multiplen Erleuchtungen loszulassen und im gegenwärtigen Augenblick anzukommen, um die Essenz meines Wesens klar erfassen zu können, anstatt meine Klarsicht durch geistige Illusion zu trüben.
Anschließend versuchte ich, mich zunächst auf meinen Beckenbodenraum zu konzentrieren. Ich richtete dabei meine Aufmerksamkeit auf den Kontakt meines Körpers mit der Sitzfläche des Rollstuhls. Ich konzentrierte mich zunächst auf meine beiden Sitzbeinhöcker, mein Steißbein sowie mein Schambein, die die vier Stützen für meinen Beckenbodenraum waren. Mein energetisches Fundament sozusagen. Ich fühlte die Tiefe und Weite dieses Raums. Mit der Einatmung ließ ich die vier Stützen maximalen Abstand halten und mit der Ausatmung hingegen ließ ich den Raum auf seine minimale Größe schrumpfen.
Nach ein paar tiefen Atemzügen in dieser Bewusstheit galt meine Aufmerksamkeit der Verbindung zwischen Hüfte und Ferse. Ich konnte dabei sehr deutlich wahrnehmen, dass sich die jeweilige Hüfte mit dem entsprechenden Fersendruck aufrichtete. Wenn ich mich beispielsweise auf den linken Fersendruck konzentrierte, konnte ich ohne jede Anstrengung beobachten, wie sich meine linke Hüfte scheinbar automatisch aufrichtete. Diese Aufrichtung schien nun erst den Durchgang für die Energie, die aus dem linken Fuß durch das linke Bein in die Wirbelsäule aufstieg, zu ermöglichen.
Gespannt wechselte ich nun und konzentrierte mich zunächst auf meinen rechten Fuß. Im Gegensatz zu meinen Beobachtungen auf der linken Seite spürte ich zu meiner Überraschung, dass sich die rechte Hüfte mit dem rechten Fersendruck vielmehr entspannte und ablegte. Durch diese Hüftbewegung schien ich das Gewicht auf die rechte Gesäßhälfte zu verlagern, was nun wiederum die Gegenbewegung, die Aufrichtung auf der linken Seite ermöglichte. Es fühlte sich an, als brauche meine linke Hüfte Aufrichtung, während die rechte Hüfte hingegen mit der Schwerkraft entspannen müsse, um sich in der Mitte zu treffen und zu vereinigen, um sodann als gebündelte Erdenergie in die Wirbelsäule eintreten zu können. Die Yogis sprachen von Ida und Pingala, die gemeinsam durch das Steißbein in die Wirbelsäule (sushumna) eintraten. Vielleicht war es in meinem Fall eine Anomalie und keine allgemeine Gesetzmäßigkeit, dass die linke Hüfte Aufrichtung brauchte und rechts hingegen Schwerkraft. Diese Vorstellung fand ihre Berechtigung auch in meiner schiefen Hüftfehlstellung, die solche gegensätzlichen Kraftrichtungen auf beiden Seiten bedurfte. Die linke Hüfte war nicht aufgerichtet und verlagerte so das ganze Körpergewicht auf die linke Seite, während die rechte Hüfte aufgerichtet war und wachsam und angespannt kein Gewicht trug. Zwischen beiden Energien (auch der weiblichen und männlichen Energie) fand keinerlei Kooperation oder Integration, geschweige denn eine Vermählung nach yogischen Ansätzen statt. Meine linke Hüfte funktionierte vielmehr wie ein Staudamm und versuchte die aufsteigende Energie zu unterdrücken, während die rechte Hüfte auf Kosten der linken Seite voll entlastet und unbeschwert agierte.
Ich atmete nun tief und lange aus, während ich mich bereits auf meine rechte Körperhälfte konzentrierte und versuchte meine rechte Gesäßhälfte mit Hilfe der Schwerkraft gegen die Sitzfläche zu pressen. Dann genoss ich zunächst den stillen Moment nach der Ausatmung und mit der nächsten Einatmung zog ich die Erdenergie durch meine linke Ferse, durch mein ganzes linkes Bein, über die aufgerichtete Hüfte in den Beckenbodenraum und mit der Ausatmung hingegen entließ ich die Energie wieder durch mein linkes Bein und schließlich meine rechte Hüfte zurück in den Boden. Meine vorgestellte Erdenergie trug dabei die Farbe Gold und so färbte ich in der Vorstellung synchron zu meiner Atmung meine Beine. Nach fünf Runden, stellte ich mir schließlich vor, dass mit der sechsten Einatmung die Energie vom Beckenbodenraum in das Steißbein durch alle Chakren aufsteigen würde.
Zunächst durchquerte der goldene Energiestrom das Wurzelchakra, das sich auf der Höhe des Steißbeins befand. Ich stellte mir vor, wie der Energiestrom mit einem Donnern durch das Energietor strömte und sich rot färbte. Nun fühlte ich deutlich mein Fundament, meine Herkunft sowie die tiefe Verbundenheit mit der Erde und ihrer Geschichte. Die rote Farbe wurde mit einem Mal zu Blut und ich fühlte die Schmerzen vergangener Kriege, die auf der Erde stattgefunden hatten, sowie derer, die noch immer andauerten. Es schien der kollektive Schmerz zu sein, den es bedeutete Mensch zu sein.
Dann stieg die rote Energie durch die Wirbelsäule auf in das Swadhistana oder Sexualchakra, was sich auf der Höhe der Geschlechtsteile befand. Die rote Energie donnerte dabei wieder durch das Energietor auf der Höhe des Kreuzbeins, etwa eine Handbreit unter dem Bauchnabel, wo es sich schließlich orange färbte. Auch an dieser Stelle konnte ich zwischen der linken und der rechten Körperhälfte zwei verschiedene energetische Qualitäten wahrnehmen. Mein Swadhisthana-Chakra fühlte sich fast an, als sei es regelrecht unterteilt. Während sich die rechte Seite sehr prall und dicht anfühlte, schien die linke Hälfte des Chakras wesentlich leerer zu sein. Ich musste mich auf die linke Seite stark konzentrieren, um das Wurzelchakra mit dem Swadhistana-Chakra energetisch zu verbinden, um den Energiestrom nicht abreißen zu lassen und so beide Hälften des Energiewirbels miteinander verbinden zu können. Um es yogisch auszudrücken, schien hier die Vermählung zwischen männlicher und weiblicher Energie nicht mühelos abzulaufen. Während die rechte Seite des Körpers auf der Höhe dieses Chakras wie ein prall gefüllter Ballon auf mehr Input mit einem Knall zu antworten drohte, schien sich die linke Hälfte des Chakras totzustellen. Die rechte geladene Chakrahälfte zog im Außen oft Wut an, da sie auf Entladung zu lauern schien. Wenn ich mit Wut konfrontiert wurde, erstarrte meine linke Chakra-hälfte weiter vor Angst, während rechts sofort das ganze Nervensystem alarmierte und in den nackten Überlebensmodus versetzte.
Ich überlegte mir nun, wie ich denn beiden Hälften gerecht werden konnte, um sie schließlich auszubalancieren und die stabile Mitte finden zu können. Wahrscheinlich musste meine linke Seite ihre Zurückhaltung aus Harmoniebedürftigkeit aufgeben und es lernen auch einfach mal krachen zu lassen. Um diesen freien Fluss wieder zu erlernen, muss sie zunächst ihre Bedürfnisse, ihre Verletzlichkeit, ihre Wut neu erfahren. Auch alte gespeicherte Emotionen werden ebenfalls frei durch diesen Fluss, da der blockierende Mechanismus, der der Harmonie zu dienen bestimmt gewesen war, nun aussetzt. Einiges, was nun hochkommt, scheint nur für mich zu sein und keine äußere Grundlage oder Rechtfertigung zu besitzen. Ich muss lernen, Schmerzen auszuhalten und darauf vertrauen, dass der Schmerz verheilen wird ohne Schutzmechanismus. Ungeschützt auf meine Stärke vertrauen. Genau darin wird die Schwierigkeit für die rechte Hälfte des Chakras liegen, die nun in ihrer Wachsamkeit zur Passivität verdammt ist. Um ihr diese Zurückhaltung zu erleichtern, werde ich mein Nervensystem herunterfahren müssen. Ich werde mich dafür bewusst meinem Hormonhaushalt widmen müssen und den Stress in meinem Alltag mehr und mehr reduzieren. Die rechte Chakrahälfte wird so entspannen und weicher werden, während die linke Chakrahälfte sich zu begreifen, auszudrücken und schließlich zu fließen beginnt. Dann ist eine gemeinsame Schnittmenge und Einheit möglich. Bereits in meiner Pubertät, war mir diese Regulierung und Neutralisierung der Hormone nicht gelungen. Die dominierende rechte Chakrahälfte hatte einfach übernommen und einen Großteil meiner Gefühlswelt so nie wirklich zugelassen und integriert.
Nun wurde mir bewusst, dass ich, anstatt entspannt das Geschehen in meinem Sexualchakra zu beobachten, nun meine Stirn in Falten gelegt hatte. Ich hatte den Dialog mit meinem Körper sozusagen für einen verkopften Monolog unterbrochen. Wie ich es in Indien gelernt hatte, atmete ich nun tief und lange aus. Dabei konnte ich fühlen, wie ich meine Vorstellungen, Ideen und Illusionen ausatmete, um mich erneut mit meiner Essenz zu verbinden und Raum für den gegenwärtigen Moment zu schaffen. Nach einer letzten Betrachtung beider Chakrahälften und einer erneuten Wahrnehmung ihrer gegensätzlichen Qualitäten und der sich daraus ergebenden Dynamiken, die eine Verbindung zu einer integrierenden stabilen Mitte unmöglich erscheinen ließen, fokussierte ich nun das Manipura-Chakra.
Das Manipura-Chakra befand sich nun zwischen Bauchnabel und Wirbelsäule. In dem Augenblick, indem die Energie durch das Energietor trat, färbte sich diese von orange zu gelb. Ich spürte, wie ich mit der Bauchatmung den Bauchnabel und das Bauchchakra dahinter zum Vibrieren brachte. Es fühlte sich an, als könne ich mit der Bauchatmung meine Perspektive wechseln und meinen Geist so gewissermaßen lenken. Atmete ich tief in mein Körperzentrum hinein, so wurde mein Kopf leichter und ich fühlte, dass ich meinen Armen und Beinen gleich nah war. Hinter mir lagen dann die kräftigen Gesäßmuskeln und unter mir mein stabiles Fundament, das mich mit Hilfe der von oben drückenden Schwerkraft in meinen Beckenbodenraum kuschelte. Zwischen meinen Beinen sprudelte meine Vagina nur so vor Lebenskraft und strotzte so der Schwerkraft. Sie ließ mich mit der Einatmung der Schwerkraft entgegenwirken und meinen Weg in Richtung Herz einlegen. Wie Luftblasen unter Wasser sprudelte die Lebensenergie völlig unbeeindruckt von der Schwerkraft in Richtung Herzzentrum und spannte meine Wirbelsäule dabei auf wie eine Perlenkette. Im Bauchchakra konnte ich erstmals die Präsenz beider entgegengesetzter Richtungen wahrnehmen. Einerseits konnte ich hier die schwere Wirkung der Gravitation wahrnehmen, die meinen unteren Rücken schließlich zusammenknautschte und jede Beckenaufrichtung verhinderte, andererseits schien hier eine der Schwerkraft entgegenwirkende Kraft zu wirken und diese aufzuheben. Dieses Aufeinandertreffen beider gegensätzlichen Kräfte führte schließlich zu einer Neutralisierung beider Kräfte, die mich dann erst in meinem Bauchchakra entspannen ließ.
Doch welche Kraft lässt uns unsere menschlichen Körper aufrichten, anstatt hilflos und magnetisch am Boden festzukleben? Welche Kraft ließ uns mit der Gravitation gewissermaßen kooperieren, indem wir uns auf die Erdoberfläche stützten? Diese Frage beschäftigte mich bereits in meiner Pubertät, als sich meine Nervenerkrankung mehr und mehr zeigte und ich die Schwerkraft als ständige Bedrohung empfand, die ich zur Aufrichtung mit all meiner Kraft besiegen musste. Damals sehnte ich mich so sehr nach einem mächtigen Himmelskörper, den ich verehren konnte und der mich die Schwerkraft lächelnd besiegen lassen würde.
Als ich vor einigen Jahren in einer Ayahuasca-Zeremonie (schamanische Medizin) den Tod erlebte, freute ich mich so sehr am nächsten Morgen wieder auf die schöne Energie, die aus der Erde in mich aufsteigen, mich aufrichten und mir Leichtigkeit schenken würde. Das klare Geschenk des Lebens war also die aufsteigende Energie aus der Erde, die mein Herz erleichterte und es hüpfen ließ. Bei der Todeserfahrung hingegen, hatte ich nur Schwere gefühlt. Nichts, was mich zum Widerstand hätte bewegen können…stattdessen nur widerstandslose Resignation.
Am nächsten Morgen fragte ich den Schamanen, was denn die, der Schwerkraft entgegenwirkende Kraft sei? Mit welcher Kraft richteten wir uns auf? Zog uns etwas zum Himmel?
Ohne lange zu zögern, antwortete der Schamane, dass es die Liebe von pacha mama sei, die aus der Erde aufsteige und uns in Richtung Himmel trug. Doch da Liebe keine physikalisch messbare Kraft war, konnte mich diese Antwort nicht ganz befriedigen.
Als ich diese Frage meinem Physiotherapeuten stellte, antwortete dieser mit „Muskelkraft“gewohnt bodenständig und unspirituell. Diese Antwort betonte die menschliche Überheblichkeit, denn ein Muskel konnte doch nur mit etwas arbeiten. Isoliert und gewissermaßen ohne universale Zuarbeit, konnte er nichts verrichten.
Auf der Suche nach etwas Höherem, dem ich mich vertrauend hingeben und die schwere Last der alleinigen Verantwortung abgeben konnte, fragte ich schließlich meinen mich ausbildenden Yogalehrer nach der uns aufrichtenden Kraft. Dieser antwortete kurz und knapp mit Prana (Lebenskraft), die in uns aufsteigt und als abhanga wieder abfließt. Dies kam dem zwar nahe, was ich in der Zeremonie erlebt hatte, jedoch war die Antwort zu allgemein für meinen nach Fakten hungernden Verstand.
Also begann ich mit meinen Recherchen in der Physik und fand schließlich in der Astro-Physik, wonach ich suchte. Auch wenn mich die Fakten vielmehr zu einer intuitiven Lösung inspirierten. Der Physiker Isaac Newton fand das Gravitationsgesetz heraus, das auch besagt, dass sich alle Körper gegenseitig anziehen. Die Sonne verfügt auch über diese Anziehungskraft. Damit zieht sie die Planeten an. Allerdings umkreisen die Planeten die Sonne in einer Ellipse und bei dieser Bewegung entsteht eine Fliehkraft. Die Fliehkraft zieht die Planeten nach außen.
Es wirken also zwei gegensätzliche Kräfte: die Anziehungskraft zieht den Planeten Richtung Sonne und die Fliehkraft zieht ihn weg von der Sonne. Beide halten sich die Waage und so bewegen sich die Planeten immer auf derselben Bahn – sie fliegen nicht auf die Sonne zu, verschwinden aber auch nicht im All. Je mehr ich mich mit physikalischen Gesetzen (der Trägheit zB)auseinandersetzte, umso verwirrter wurde ich.
Ich beschloss, meinen goldenen Mittelweg zu finden zwischen meinem nach physikalischen Fakten der Realität hungerndem Verstand und meiner davon losgelösten spirituellen inneren Stimme. Also bettete ich meine Intuition, die an Leben und Licht der Sonne glaubte, in Newtonsche Gesetze gewissermaßen.
Innerhalb des Planeten Erde wirkte somit die Erdanziehung, als auch gleichzeitig die Anziehung zur Sonne, wodurch sich der lebendige menschliche Körper permanent in einem Wechselfeld beider Anziehungskräfte befand. Ich stellte mir dabei vor, dass sich die Sonne eben so weit weg befand, dass sie uns nicht schweben ließ. Die Sonne somit als Gegenpol für Schwerkraft und gewissermaßen als Quelle der Leichtigkeit zu betrachten gefiel mir, denn dies schien auch zu erklären, warum im Sommer alles irgendwie leichter und müheloser war, als im Winter.
Zudem ließ die Sonne durch ihr Licht die Pflanzen wachsen und sie so der Schwerkraft trotzen.
Ich schloss meine damalige Recherche also mit dem Ergebnis ab, dass die Sonne mein Held war, die mich lächelnd im Dienste des Lebens die Schwerkraft mit hüpfendem Herzen besiegen ließ.
Damit hatten alle irgendwie recht gehabt: der Schamane mit Liebe, denn auch bei Verliebtheit werden die gleichen Hormone freigesetzt wie bei Sonnenschein, der Physiotherapeut mit der Muskelkraft, da die Sonne dem menschlichen System Leben einhaucht, als auch mein Yogalehrer mit Prana, weshalb die Yogis mit dem Sonnengruß diese huldigten.
Als ich begriff, dass mich meine Erinnerung an die Vergangenheit den gegenwärtigen Augenblick und damit die spontanen lebendigen Impulse des Manipura-Chakras versäumen ließ, hielt ich inne und konzentrierte mich auf meine Atmung. Mit der Einatmung verlängerte ich die Strecke zwischen Wirbelsäule und Bauchnabel, mit der Ausatmung hingegen, ließ ich beide sich wieder annähern.
Während ich im Sexualchakra noch die Gegenüberstellung zweier sich widersprechenden energetischen Qualitäten erlebt hatte, schienen sich nun im Manipura-Chakra zwei gegensätzliche Kraftrichtungen gegenüberzustehen – Leichtigkeit und Schwere. Die aufsteigende Leichtigkeit schien jedoch durch einseitige Bauchmuskelverspannungen unterdrückt zu werden, während die herunterziehende Schwere dominierte. Ich erinnerte mich an eine sehr schöne Erfahrung während meines Aufenthalts in einem indischen Ashram, die ich in meiner Autobiografie wie folgt beschreibe:
„Als wir das Manipura–Chakra auf der Höhe des Bauchnabels mit der Atmung aktivierten, fing ich plötzlich an, mich heftig zu schütteln. Die Kraft, die diese Bewegung auslöste, kam aus meinem Bauch. Es fühlte sich an, als würde in einem sehr kraftvollen Erdbeben ein Hochhaus in meinem Körper einstürzen. An der Stelle, wo das Gebäude eingestürzt war, war nun ein weiter Platz in meinem Bauch entstanden. Dort konnte ich nun die Nervenbahnen entlang meiner Beine bis zu meinen Füßen klar fühlen. Meine Füße fühlten sich so leicht und klar an. Durch das heftige Durchschütteln war ich vom Schneidersitz rückwärts umgefallen. Ich lag nun also auf dem Rücken auf der Matte und öffnete vorsichtig meine Augen. Während Mattaji die Meditation weiterleitete, richtete ich mich erneut auf und stellte meine entspannten Füße flach auf den Boden. Monique, eine etwa fünfzigjährige französische Reiki–Meisterin, öffnete ihre Augen. Sie sah mich so dasitzen und wortlos setzte sie sich auf meine entspannten Füße. Da ich mich so an ihren Schultern abstützen konnte, gelang es mir, mich mit dem Gewicht auf meinen Füßen aufzurichten. Zuerst fing ich an, laut und hysterisch los zu lachen, dicht gefolgt von lautem Weinen. Ich hatte keine Kontrolle und wurde von meinen Emotionen nun völlig willkürlich überwältigt. Die anderen Kursteilnehmer waren auf mich aufmerksam geworden und hatten ihre Augen geöffnet. Als sie mich so völlig überwältigt, aber kerzengerade dastehen sahen, glaubten alle an ein Wunder und manche fingen an zu weinen.
Ich war zwar weit davon entfernt einen Schritt zu gehen, jedoch trugen meine Füße mein Gewicht so selbstverständlich und widerstandslos, dass ich es nicht fassen konnte. Es war so völlig ohne eigene Anstrengung ein Geschenk des Universums, was ich da erfuhr. Ich empfand mein Körpergewicht derart leicht und das aufrechte Stehen als eine sehr natürliche, entspannte Haltung, die nicht von der Gravitation bedroht wurde.“ (Zitat Goldregen)
Was ich damals erfahren und noch nicht verstanden hatte, war, dass Leichtigkeit und Schwere zum ersten Mal im Gleichgewicht waren. Die verkrampften angespannten Bauchmuskeln hatten sich gelöst und somit die einströmende Leichtigkeit meiner linken Körperhälfte zugelassen. Schwere wurde nun mit Leichtigkeit in meinem Bauch gemischt, was mich nun der Schwerkraft entspannt widerstehen ließ.
Die plötzliche Entspannung meiner linken Bauchmuskeln, die mit ihrer Kontraktion die gefährliche Erdanziehung verhindern wollten, kam energetisch einer Resignation meines Körpers gleich. Diese mühelose Akzeptanz der Erdanziehung wurde vom Universum liebevoll aufgefangen und abgefedert. Dies erinnerte mich an meinen morgendlichen Tee, auf dessen Teebeutel zu lesen war, dass wir dahin gehen sollten, wo die Angst sei, da dahinter unsere Träume warteten. Todesmutig hatte ich alle Mechanismen unterlassen, die sich mein System im Laufe der Jahre angeeignet hatte, um einen Fall zu vermeiden. Mein Körper war nun unbeschüzt. In dieser unkontrollierten, mutigen Freiheit konnte das Universum nun mit mir arbeiten. Es federte, die an mir ziehende Schwerkraft liebevoll ab und schenkte mir mich aufrichtende, ausgleichende Leichtigkeit, an die ich mich in meinen wildesten Träumen nicht zu glauben gewagt hätte.
Ich konzentrierte mich nun wieder auf meine Atmung, um nicht mit der Erinnerung an die Vergangenheit die Gegenwart auszublenden. Mein Bauch schien voller Leben zu sein. Wenn ich tief in ihn hineinatmete, so dass Bauchnabel und Wirbelsäule auf ein Maximum entfernt waren, so fühlte ich Verantwortung, Wut, einen animalischen Überlebenstrieb und unendliche Kraft. Mein Gehirn assoziierte einen gefährlichen Kontrollverlust und versuchte daher mit einem permanent angespannten Muskelpanzer vor allem auf der linken Seite den Bauch unfrei zu halten und seine Lebendigkeit zu zensieren. Tiefe Bauchatmung hingegen schenkte ihm Leben und einen Platz in der Welt.
Nun stellte ich mir vor, wie die Energie durch die Wirbelsäule weiter aufstieg und schließlich das Herzchakra durchquerte.
In Indien lehrte man mich, dass auf der rechten Seite der Wirbelsäule das spirituelle Herz lag, während auf der linken Seite das weltliche Herz lag. Dazwischen, auf Höhe der Wirbelsäule, befand sich das Herzchakra. Meine rechte Seite, also mein spirituelles Herz, war, entsprechend der Energie auf der rechten Seite, prall gefüllt und aufgerichtet. Es fühlte sich stolz und entschlossen an. Mein spirituelles Herz schien zu brüllen wie ein Löwe.
Mein weltliches Herz dagegen schien nicht frei genug schlagen zu dürfen, um sich zu erheben und für seine volle Kraft zu öffnen. Es schien im Gegenteil keine Leichtigkeit zu erfahren und Richtung Bauch zu rutschen. Meine linke Schulter hing ebenso nicht aufgerichtet und bedeckte dabei mein Herz wie ein Schutzschild. Bewusst atmete ich nun in meinen Brustkorb und klappte dabei die Schultern zurück, so dass sich am Rücken beide Schulterblätter berührten. Ich richtete meine linke Körperhälfte auf, indem ich versuchte, den Abstand zwischen linkem Sitzbeinhöcker und Herz auf sein Maximum zu verlängern. Mein Herz war nun dem Himmel zugewandt und schien weit geöffnet. In dieser ungeschützten Position fühlte ich seine Zartheit und Verletzlichkeit. Ich spürte, dass mein Nervensystem in dieser Haltung in erhöhter Alarmbereitschaft war und sich nicht bescheiden hingeben konnte. Ich fühlte die Pflicht zur engen Kontrolle, die dem Verantwortungsgefühl und auch Instinkt einer Mutter ähnelte. Bei der kleinsten Veranlassung würde es alle meine Muskeln zusammenziehen und mein Herz nicht mehr frei schlagen lassen. Wie konnte ich diesen Mechanismus löschen, der vielleicht einst wichtig für mein Überleben war? Wie konnte ich meinem Gehirn beibringen, dass mein Herz die Schmerzen, die ihm das Leben zufügen würde, aushalten würde? Wie konnte ich mein ungeschütztes sensibles Herzchen frei schlagen lassen und mich auf seine Stärke und Resilienz dabei verlassen? Ich beschloss von nun an, verstärkt meinen Fokus darauf zu richten. Ich wollte bereits die feinsten subtilen Angriffe auf mein Herz wahrnehmen, meine Verletzung fühlen und meinem Herzen Zeit geben, um sich selbst zu heilen, anstatt sich von dem Schutzmechanismus meines Nervensystems fangen und einfrieren zu lassen. Während mein System dann litt in diesem toxischen halbtoten Autopiloten, war meine Haltung meiner Umwelt gegenüber verbittert und aggressiv. Ich war dann auf der Suche nach Schmerz, anstatt nach heilsamer Liebe.
Von nun an wollte ich mein Herz weit öffnen und alles ungefiltert hereinlassen. Ich wollte alle Schmerzen in meinem Herzen aushalten mit dem Vertrauen, dass meine Herzenskraft unzerstörbar wäre und sich immer wieder heilen würde. Schmerzen auszuhalten schien der Preis des Lebens und der Liebe zu sein. Die Angst vor Schmerzen hingegen trug den Preis des Lebens und der Liebe. Die pure Angst machte schwer und war tot. Liebe machte leichtfüßig und war lebendig. Sie schien das Gegengift zur Angst zu sein. Die einzige Art, mein kleines naives, liebendes Herzchen zu schützen, erschien mir, meine Liebe zu streuen und nicht alles auf eine Karte zu setzen. Ich wollte mein ganzes Leben, mein ganzes Umfeld mit Liebe bestäuben, anstatt nur eine Pflanze voller Liebe zu gießen und einen Totalschaden zu erleiden, wenn sie verwelkte. Damit meinte ich nicht etwa Polyamorie, denn was Beziehungen anging, wusste ich, dass ich mir das klassische YinYang-Zweiermodell wünschte. Vielmehr wollte ich keine exklusive personenbezogene Liebe. Ich wollte einfach lieben was das Zeug hielt-präventiv, um breit genug aufgestellt zu sein. So könnte ich meiner Angst begegnen und dennoch mein Herz frei schlagen lassen.
Entschlossen atmete ich weiter in meinen Brustkorb. Dabei richtete ich meine Wirbelsäule so auf, dass es so aussah, als böte ich mein Herzchakra dem Himmel auf einem Tablett an.
Nun richtete ich meine Aufmerksamkeit auf das Halschakra auf der Höhe des Kehlkopfes. Ich spürte immer wieder, dass durch meinen „Schildkröte“-ähnlich hervorstehenden Kopf die Verbindung zu den unteren Chakren, also Wurzel-, Sexual-, Bauch-und Herzchakra gestört und somit der Energiefluss blockiert war. Meine Stimme verfügte auch über einen ganz anderen Klang, wenn sie die Chakren und damit meine Innenwelt integrierte. Im Gegensatz dazu war es akustisch sehr deutlich, wenn sie abgespalten und nicht in Verbindung war. Sie hatte dann ihre Quelle, ihren Ursprung nicht tief in meinem Körper, was zu hören war. Sie klang dann eng und aus dem Hals gequetscht. Dieser Klang meiner Stimme war meist ein Indiz, dass ich unterbewusst versuchte, meine Innenwelt zu zensieren. Zum Beispiel war ich erschöpft, beschämt, wütend, ängstlich oder verletzt und wollte dies nicht ausdrücken, so zeigte sich meine Halsstimme…..ein Fake sozusagen! Ein Betrug. Doch die Frage war, wen betrog ich damit? Mein Umfeld oder vielmehr mich selbst? Wahrscheinlich beide, denn niemand hatte etwas von dieser halbherzigen Fake-Version. Manchmal blieb mir die Stimme sogar ganz weg, wenn ich wütend oder aufgeregt war. Dies empfand ich dann immer besonders demütigend. Mein Körper machte meiner Abspaltung sozusagen einen Strich durch die Rechnung. Kein Pokerface auf Kosten meiner Innenwelt. Tobte mein Bauch vor Wut, so wollte sie auch irgendwie ausgedrückt werden. Sie wollte in meiner Stimme mitschwingen, anstatt mit einer künstlich ruhigen Tonlage abgetötet zu werden. So war es dann auch, wenn ich aufgeregt war und dies mit einer gleichgültigen Stimme unterdrücken wollte.
Ich versuchte, mir vorzustellen, dass ich meinen Hals mit der Atmung weit machen und die Blockaden einfach wegpusten würde. Nichts sollte mich meine Innenwelt verraten lassen. Mein Leben und damit mein Ausdruck sollte eine Sache zwischen Gott und mir sein. Unterdrücken war damit völlig unmöglich und auch sinnlos. Etwa so, als miaute ein Löwe wie eine kleine Stubenkatze, um dazuzugehören, anstatt zu brüllen. Diese Anpassung schien als eine Form der Selbstsabotage nichts und niemandem zu dienen. Weder den anderen Stubenkatzen noch dem Löwen selbst. Der Löwe würde, selbst wenn er miaute, kein Zusammengehörigkeitsgefühl erschaffen können. Die einzige ihm verbleibende Option, falls er das äußere Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Stubenkatzen als unerlässlich erachten sollte, ist es zu brüllen und darauf zu vertrauen, dass die Katzen ihn als Löwe schätzen und in ihre Gruppe aufnehmen würden. Keine Zensur im Ausdruck. Keine künstliche Harmonie im Außen auf Kosten der inneren. Integrität und Freiheit. Diversität. Inklusion.
Nun versuchte ich die Energie dabei zu beobachten, wie sie zu meinem dritten Auge aufstieg. Dazu konzentrierte ich mich auf den Punkt zwischen meinen Augenbrauen und kullerte meine Pupillen mit geschlossenen Augen nach oben. Ich sah dabei ein weißes Licht, was auf mich schien. Das weiße Licht, zu dem ich aufblickte, war außerhalb meines Körpers und machte mir meine körperliche Bedeutungslosigkeit bewusst. Dabei spürte ich eine tiefe Erleichterung. Es fühlte sich an, als würde mir ein Stein vom Herzen fallen, und meinen Schultern wurde die schwere Last von tiefen Schuldgefühlen genommen. Diese kindliche Verantwortungslosigkeit gab mir ein unendliches Freiheitsgefühl. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das aus dem Kinderwagen zu seiner Mutter aufblickt. Es schien etwas höheres als mich zu geben. Dieses Gefühl der eigenen Begrenztheit vermittelte mir ein tiefes Gefühl der Bescheidenheit, was meine Muskeln nun völlig loslassen und entspannen ließ.
Das weiße Licht leuchtete genau in der Mitte zwischen rechts und links, meinen beiden Polaritäten. Das Licht erinnerte mich an meinen Fokus. Sowohl an meinen körperlichen, als auch an meinen geistigen Fokus, die teilweise sogar deckungsgleich waren. Mein körperlicher Fokus wollte mein Herz und damit meine linke verlangsamte, weiche, schwächere Seite und meine rechte verbissene, ehrgeizige, ungeduldige Seite zusammenbringen und beide Seiten optimal kooperieren lassen.
Mein geistiger Fokus wollte ein Gleichgewicht zwischen meinen Gefühlen und meinem Verstand herstellen. Meine geistigen Bewegungen sollten eine Reaktion sein, die beide Pole gleichermaßen integrierte. Nur dann würde ich integer und somit stabil und entschlossen durchs Leben gehen können.
Das dritte Auge beschäftigte mich also mit der Harmonisierung beider Gehirnhälften und damit beider Energien. Das dritte Auge schien die goldene Mitte zu sein, die mich dem Strahl entlang dem Licht entgegenwachsen ließ.
Auf dem Weg in das weiße Licht beobachtete ich nun, wie die gebündelte Energie durch das Kronenchakra aufstieg. Das Kronenchakra schien auf dem Weg zu dem weißen Licht zu liegen. Ein Zwischenstopp sozusagen. Es befand sich an dem höchsten Punkt meines Schädels. Dort war die menschliche Energie dem Himmel am nächsten. In Indien, wo ich einige Zeit in einem Ashram leben durfte, lehrte mich ein Yogi, dass die Energie auf der Höhe des Kronenchakras bereits vollkommen sei. Sie habe das menschliche System bereits überwunden und mit ihrem Austritt erklärten wir uns mit dem natürlichen Zyklus von Leben und Tod einverstanden. Jedes Mal, wenn die Energie über das Kronenchakra aus unserem System ins Nirvana austrete, sei dies ein kleiner Tod. Jedoch trete sie zur gleichen Zeit durch unsere Füße erneut Energie in unseren Körper, was mit der Geburt den Zyklus vervollkommne. Wir sollten dabei mit der Energie haushalten, als tauchten wir mit einer klebrigen Hand durch Sand. Der Sand, der nicht hängen blieb und uns durch die Finger rannte, war nicht für uns. Wir sollten ihn loslassen und ihm einfach keine Beachtung schenken.
Langsam öffnete ich nun meine Augen und als mein Blick auf die Uhr fiel, bemerkte ich, dass ich über eine Stunde meditiert hatte. Es hatte sich sehr viel kürzer angefühlt! Ich strahlte über das ganze Gesicht und war so kraftvoll von Kopf bis Fuß! Ich hatte mich energetisch aufgeladen und es mir sozusagen selbst besorgt! Völlig unabhängig und autark! Das Einzige, was ich gebraucht hatte, war: die Präsenz meines Körpers, meine geistige Aufmerksamkeit und schließlich Offenheit, um Bereicherung durch meine Seele zu erfahren! Ich beschloss, eine kleine Pause einzulegen, bevor ich die Performance einmal langsam und bewusst durchgehe wollte.
Nach der Pause wollte ich mich noch zehn Minuten mit einer kurzen buddhistischen Rezitation geistig ausrichten, bevor ich schließlich mit der Körperarbeit beginnen würde. Ich begann ein buddhistisches Mantra, das soviel bedeutet wie „Ich widme mein Leben meinen Träumen“, für einen Zeitraum von zehn Minuten zu wiederholen. Dabei starrte ich konzentriert auf die Wand und fixierte einen Punkt. Während das Mantra all meine Chakren vibrieren ließ und meine Stimme wiederum meine Chakren energetisch spiegelte, ging mir meine Performance durch den Kopf. Ich sah mich in meinem wunderschönen lila Outfit, das mir meine Freundin nähte. Da fiel mir ein, dass ich sie fragen sollte, ob wir den Termin für die Anprobe vorverlegen könnten, damit ich einen Probendurchgang mit dem Outfit machen könnte und wir danach noch Zeit hätten, eventuelle Veränderungen vorzunehmen. Ich konnte regelrecht wahrnehmen, wie sich meine Stimme zu einem flachen, eindimensionalen Gebrabbel aus meiner Halskehle verwandelt hatte, in dem Moment, als mir der Gedanke gekommen war. Ich versuchte, die organisatorischen Dinge auf die Rückfahrt zu verschieben, um jetzt loszulassen und im Moment bleiben zu können. Dann atmete ich lange aus und versuchte mich erneut in meiner Bauchgegend zu sammeln. Die Rezitation klang nun wieder tiefer und irgendwie aus einer anderen Dimension.
Nachdem ich die buddhistische Rezitation beendet hatte, begann ich mit der Körperarbeit.
Ich wollte zunächst im Rollstuhl sitzend mit der Schwerkraft arbeiten. Zunächst wollte ich mich kopfüber hängen lassen und die Schwerkraft mich widerstandslos besiegen lassen. Volle kampflose Hingabe. Entspannung. Sodann wollte ich tief einatmen und mit der Aufrichtung beginnen. Mit der Einatmung wollte ich bereits bewusst meine Lebenskraft stärken, um mich aufrichten zu können. Dieses intendierte Einatmen sollte mich bewusst auf die physische Aufrichtung meines Körpers vorbereiten. Ich atmete ein und stellte mir vor, dass ich durch meine Füße atmete und der Atem mich zur Aufrichtung beflügelte. Dann begann ich mich synchron zur Atmung aufzurichten. Hier war für mich die Entschleunigung meines effektgeilen Geistes hin zur ehrlichen Körperarbeit herausfordernd. Damit meine ich, dass mein Geist geduldig und zurückhaltend die Transformation meines Körpers von Sauerstoff in Lebenskraft beobachten sollte, ohne sich einzumischen. Gut gemeint, aber dennoch völlig übergriffig und kontraproduktiv für die Körperarbeit, denn in dem Moment wo sich mein Geist einschaltete und damit körperliche Vorgänge aus dem Unterbewusstsein in das Bewusstsein holte, verzerrte ich diese Übersetzung, diesen Stoffwechselvorgang von Sauerstoff in Lebenskraft.
Ich versuchte meine Aufmerksamkeit auf den vorgestellten Energiestrahl aus der Erde zu bringen, der durch meine Füße, durch meine Beine zur Hüfte floss und dann durch das Steißbein in die Wirbelsäule emporstieg und mehr und mehr meinen Oberkörper aufrichtete. Zu guter Letzt wollte ich dann schließlich meine Arme ausbreiten, als würde ich die ganze Welt umarmen wollen, und mein Herz weit öffnen. Ich wollte dabei ehrlich vorgehen und meine Performance im gegenwärtigen Moment entstehen lassen, anstatt einst gefasste Entschlüsse zu rekonstruieren.
Dann wollte ich mich vom Rolli auf den Boden begeben. Wie genau war mir noch etwas unklar. Sollte ich diesen Transfer wie ein Fallen aussehen lassen, also etwas dramatisch inszenieren, oder wollte ich eher neugierig wirken und dann mutig den Absprung wagen?
In Bauchlage wollte ich dann jedenfalls auf dem Boden ankommen und mich mit Robben und seitlichem Wälzen fortbewegen. Dabei wollte ich die bei der Feldenkraistherapeutin erlernten Techniken anwenden. Bewusst wollte ich mit meiner Hüfte mein Gewicht verlagern und meinen Körper drehen. Dann wollte ich über den Vierfüßlerstand zum Sitz kommen und dann den „Schneidersitz bauen“, wie ich es mit Sarah geübt hatte. Nachdem ich dann geduldig und mit tiefer bewusster Atmung im Schneidersitz angekommen war, wollte ich mich gerne über die Stimme ausdrücken, wie ich es bei Stefanie gelernt hatte. Ich wusste nicht, ob ich ein Lied singen, ein Mantra rezitiern oder eine Meditation führen wollte. Würde ich überhaupt noch Puste dafür haben oder sollte mich Yango besser vorher aufnehmen, so dass meine Stimme am Ende der Performance als Voice-over zu hören sein könnte?
Erschöpft schaute ich nun auf die Wanduhr und stellte fest, dass mir eigentlich noch eine volle Stunde Arbeitszeit verbleiben würde, doch ich könnte spüren, wie erschöpft ich war. Mit einem tiefen Seufzer ließ ich mich auf meinen Rücken umfallen und beschloss nach Hause zu gehen. In diesem erschöpften Zustand war das Gehirn sicher nicht mehr im Stande, wirklich kreativ und produktiv zu arbeiten. Es würde im gehetzten Überlebensmodus auf alte festgefahrene Programme zurückgreifen, anstatt mit weitem, distanzierten Überblick aus der unendlichen Reichweite des Augenblicks wirklich schöpfen zu können.
Entschlossen nun wieder den Heimweg anzutreten, rief ich den Namen meines Assistenten, um meine Schuhe an- und die Knieschützer ausziehen zu lassen. Anschließend half er mir wieder vom Boden hoch auf den Rolli. Zunächst nahm ich den leichten Tanzrolli, um die Bühne und damit den feinen Tanzboden zu verlassen. An der Studiotür wechselte ich dann auf meinen elektrischen Straßenrolli. Ich trank noch etwas Wasser, ging noch einmal auf die Toilette und zog meine Jacke an sowie Kopfhörer und Mütze auf. Nachdem mir mein Assistent dann half, den Rucksack wieder an den Rolli zu hängen, Musik und Lichter auszuschalten sowie das gekippte Fenster zu schließen, sah ich erneut zur Wanduhr und stellte fest, dass nun fast eine Stunde vergangen war. Crip time. Immer vergaß ich diese zeitaufwendigen Zwischenschritte miteinzuplanen und war dann verärgert, wenn ich meinem Zeitplan hinterherhinkte. In einer Tanzcompany, für die ich einmal arbeitete, hatten wir gelernt, beim Tanz eben genau diese Übergänge zu betonen. Der Weg ist das Ziel. Im gehetzten Überlebensmodus sah ich in meinem effektgeilen Tunnelblick nur das Ziel und war genervt von den zeitfressenden Übergängen. Es war genau diese sture Einstellung, die mich ungeduldig und gestresst sein ließ. Mein Nervensystem war so stets angespannt und zeitlich mit allem im Verzug. Es waren die kleinen alltäglichen Zwischenschritte, die emotional so anstrengend für mich waren, da mein Körper soviele Stresshormone ausschüttete, die ihn nicht entspannen ließen. Um körperlich wirklich entspannen zu können, musste der kleinste Zwischenschritt als ein Schritt existieren dürfen ohne geistigen Widerstand oder Ablehnung. Er war auch nicht minder wichtig und verdiente genausoviel Aufmerksamkeit wie alle andern. Er fühlte sich für meinen Körper genauso anstrengend an wie all die großen Herausforderungen und verdiente daher auch geistig beachtet zu werden.
Wir machten uns nun auf den Heimweg und ich versuchte, die kleinsten Zwischenschritte dieses Heimwegs wahrzunehmen, von Handschuhe anziehen, Rollielektrik an- oder ausschalten, über Bus-Stoppknopf drücken, Aufzüge nehmen zu Haustür aufschließen.
Zuhause nahm ich nach dem Essen ein Fußbad und ging früh ins Bett.
Nachts träumte ich von einem Puzzle, das aus riesigen dreidimensionalen Puzzleteilen bestand. Ich suchte panisch und verzweifelt in diesem riesigen Berg von Puzzleteilen nach einem ganz bestimmten Teil. Die Puzzleteile vibrierten ähnlich meinem Herzschlag und je hektischer ich suchte, umso mehr fing der ganze Haufen von Puzzleteilen an zu vibrieren. Als ich irgendwann heulend und verzweifelt suchend unter dem erdbebenähnlichen Haufen verschüttet wurde, wusste ich, dass ich auf der Suche „über meine eigene Leiche“ gegangen war. Schweißgebadet und mit rasendem Herzen wurde ich wach. Ein tiefes Gefühl von Schuld und Versagen überkam mich. Ich hatte auf der verzweifelten, gierigen Suche nach irgendetwas, mein Leben geopfert. Welches Teil hatte ich denn überhaupt gesucht? Was wäre passiert, wenn ich das Teil gefunden hätte? Hätte sich der Herzschlag sowie die Vibration tatsächlich beruhigt oder ging es überhaupt nicht um das Teil und der zitternde Berg hätte mich dann genauso begraben? Hätte es wirklich in diesem Berg auch nur ein Teil geben können, was mich befriedigt und meine gierige Weitersuche verhindert hätte?
Da ich nun das Rattern in meinem Kopf, dem ich nun so bewegungslos daliegend ausgeliefert war, nicht mehr aushalten konnte, stand ich mit stechendem Kopfschmerz auf. Alles war so mühevoll, wenn mein Kopf nicht frei war und schmerzte. Zunächst transferierte ich mich vom Bett auf den Rollstuhl, dabei wuchtete ich meine Hüfte zunächst mit durchgestreckten Beinen vom Bett auf den Rollstuhl. Dann griff ich in jeweils eine Kniekehle bis die Spannung der Streckmuskulatur nachließ und ich die Füße nacheinander auf das Fußbrett des Rollstuhls stellen konnte. Nun konnte ich mein Gesäß hochstemmen und ins Badezimmer rollern, wo ich, um die Toilette zu benutzen, einen ähnlichen Transfer vorzunehmen hatte. Ich fragte mich, ob ich denn den heutigen Arbeitstag nicht einfach ausfallen lassen wolle, da ich mir nicht vorstellen konnte, in diesem Zustand irgendwie ideenreich und schöpferisch arbeiten zu können. Ich würde mich dahinquälen und auf der Suche nach etwas im Außen über meine eigene Leiche gehen. Genau wie in meinem Traum. Ich entschied mich, trotz Zeitdruck und noch vieler ungelöster Aufgaben vor der in drei Tagen anstehenden ersten solistischen Performance, für meine Innenwelt und blieb zuhause. In einem solchen unharmonischen inneren Zustand konnte ich nichts für meine Außenwelt tun. Von diesem Ort konnte ich keine Liebe in die Welt schicken, sagte ich mir mantra-artig auf und kroch nach dem Frühstück und einer Schmerztablette wieder unter meine Bettdecke.
Nachdem ich direkt eingeschlafen war, wurde ich 1,5 Stunden später ohne starke Kopfschmerzen wach. Ich fühlte mich nun so erschlagen, als hätte ich innerlich stark gekämpft. Zwar war ich nun zu kraftlos, um mich über meinen Sieg wirklich freuen zu können, jedoch genoss ich nun meinen inneren Frieden. Während ich an die Decke starrte, konnte ich nun wahrnehmen, wie sehr ich mich in diesem schrillen, lauten bunten Leben nach einer weißen Wand gesehnt hatte, auf die ich all mein chaotisches Kopfkino projizieren konnte ohne im Gegenzug Informationen aufnehmen zu müssen. Ich konnte mich richtig ausleeren mit tiefer Bauchatmung. Mit jeder tiefen, langen Ausatmung bemerkte ich nun, dass meine Kopfschmerzen immer weniger wurden.
Als Steffi gegen Abend zur Kostümanprobe vorbeikam, war ich zwar immer noch kraftlos, aber auch entspannt und völlig schmerzfrei. Es machte nun Spaß das schöne Kostüm für die Performance zu bestaunen und mit meiner Freundin anzuprobieren. Ich war nun innerlich wieder in Frieden und bereit für die verbliebenen drei Tage Finale meines Projektes.
Am nächsten Tag (2 Tage zur Performance) fuhr ich sehr entspannt zu dem Tanzstudio in Wedding. Ich war fest entschlossen, mich nicht zu stressen und mir die Freude zu bewahren. Aus diesem Grund hatte ich doch mein juristisches Referendariat damals abgebrochen. Ich war damals ausgestiegen, um meine innere Stille zu finden. Wollte ich nun ernsthaft meine Kunst, die meine Essenz, mein Inneres war, systematisieren und so völlig ungeschützt lieblosem vernichtendem Zeitdruck aussetzen? Wollte ich nun mein Herz einfangen, damit es im Rhythmus der Zeit schlägt?
Nein, es war im Gegenteil, eine meiner Lebensaufgaben, mein Inneres als mein höchstes Gut vor krankmachendem Stress zu bewahren und vor jeder zeitlichen Begrenzung. Mit dieser form- und zeitlosen Erhabenheit machte ich mich an die Arbeit.
Ich wollte zunächst allgemein mit Forschungen zum Thema Lagesinn beginnen, sowie weitere körperliche Grenzerforschungen durch meine eigens entwickelte „Bordering-Methode“anstellen.
Bei dieser Körperarbeit müsste ich geistig und körperlich im gegenwärtigen Moment sein. Das heißt, dass meine mentale Aufmerksamkeit sich nur mit meinen körperlichen Einschränkungen in diesem Moment beschäftigen sollte. Sie sollte nicht versuchen, über die Zukunft nachzudenken und sich beispielsweise um die Performance zu sorgen. Mein Körper würde darauf mit Angst und Nervosität reagieren und den gegenwärtigen Moment nicht fühlen.
So fing ich also mit meiner „Bordering“-Methode an und schaffte es nach etwa zehn Minuten, meinen widerspenstigen Geist zu zähmen. Die Belohnung war nun tiefste körperliche sowie mentale Versenkung in dieser friedlichen Spielerei. Mit dieser Methode konnte ich zunächst die Grenzen meines Körpers erfahren, um sie dann im zweiten Schritt durch gesteigerte Bewusstheit ein kleines Stück erweitern zu können.
Dabei streckte ich beispielsweise meinen linken Arm soweit zur linken Seite aus, dass meine Fingerspitzen einen imaginären Punkt erreichten. Dies war nun die erste scheinbare Grenze, die es im zweiten Schritt zu erweitern galt.
Jetzt konnte beispielsweise die ganze Schulter der Bewegung folgen, so dass sich der ganze Oberkörper nach links verschob, was die Hüfte zum Ausgleich zwang. So entstand eine ganze Kette, die das volle Potenzial des Körpers erst entfaltete. Die geistige Arbeit dabei war, diese Kette mit Bewusstheit zu verfolgen.
Wo gab es eine Blockade, die das Ziel der Grenzerweiterung nicht mitverfolgte und stattdessen diesen bewussten Entschluss still und heimlich boykottierte? Welcher Teil meines Körpers leistete Widerstand und zerriss sich nicht sein letztes Hemd für meine Ideen, Ziele und Träume? Bei dieser Arbeit stellte ich fest, dass der untere Rücken bei der Bewegung nicht mitmachte und so eine Optimierung der Bewegung sowie eine klitzekleine Grenzerweiterung nicht erlaubte. Mein erster Gedanke war, dass ich das wegen meiner Behinderung nicht konnte. Doch dann musste ich selbst über meine Diagnose lachen, die so oberflächlich war. Mein Geist stempelte jede körperliche Opposition als „behindert“, „defekt“ ab. Echte Beziehungsarbeit war nur dann möglich, wenn jede Meinung Raum hatte und nicht ungehört blieb.
So versuchte ich herauszufinden, was den unteren Rücken die Bewegung blockieren ließ. Was steckte hinter der Todesstarre, die jede freie Aufrichtung der Wirbelsäule und jede Beweglichkeit der Hüfte verhinderte? Mit der Zeit fand ich heraus, dass der Wirbel auf dieser Höhe der Wirbelsäule, der den Energiefluss quasi abtötete, an der Rückenlehne des Rollstuhls „klebte“ und so den Unterkörper von der Bewegung abtrennte. Indem ich mich nach vorne zog, löste sich der Wirbel von der Rückenlehne. Meine aufgerichtete Hüfte musste nun das Gewicht tragen und ausbalancieren. Ich drohte bei dem Versuch, meine stabile Mitte zu finden, vom Rolli zu fallen. Mit erhöhtem Herzschlag legte ich die Hüfte wieder zurück und lehnte den Wirbel erneut gegen die Rückenlehne. In diesem Zustand konnte ich mich nun wieder beruhigen. Nun verstand ich diesen Wirbel und seine Motivation. Mein Gehirn hatte anscheinend in früheren Jahren die Erfahrung gemacht, dass eine durchgehende Aufrichtung der Wirbelsäule zu einem Sturz führte und wollte dies daher durch eine Blockade vermeiden. Die Todesstarre wollte mich also nur davor bewahren, hinzufallen und war dazu bestimmt, meiner Sicherheit zu dienen.
Direkt suchte ich mir einen Schal, mit dem ich meine Hüfte mit der Rückenlehne verknotete. Damit konnte ich einen Sturz vom Rollstuhl ausschließen. Erstaunlicherweise konnte ich nun beobachten, wie der untere Rücken mehr Beweglichkeit zuließ. Die nun entstandene Sicherheit veranlasste den Wirbel die Blockade aufzulösen, sich von der Rückenlehne vorsichtig zu lösen und eine durchgehende Aufrichtung zuzulassen.
Nun konnte ich durch eine ausgleichende Hüftbewegung mit meinem linken Arm noch weiter zur Seite reichen, so dass meine Fingerspitzen nun die anfängliche Grenze mit Leichtigkeit erweitern konnten.
Bei dieser Arbeit stellte ich fest, dass wirklich alles einen Sinn hatte und der schulmedizinische Stempel, der von „behindert“und „defekt“ sprach, den Geist zu falschen Schlüssen führte. Mein Körper hatte die gleichen Ziele wie mein Geist. Für ihn standen auch Überleben und Sicherheit an erster Stelle. Lediglich waren beide anders programmiert, was intern zu Missverständnissen führte. Diese Programme meines Körpers wollte ich mit Bewusstheit fluten, um meine Körpersprache zu decodieren und ihren Sinn zu verstehen.
Nachdem ich immer wieder körperliche Grenzen aufgesucht und hinterfragt hatte, sowie dabei auch bewusst mein angespanntes Nervensystem ausgehalten hatte, um weiterzugehen und die körperliche „Sicherheitszone“ zu verlassen, war ich erschöpft und musste eine kleine Pause an der frischen Luft machen. Dieses „den Körper immer wieder überreden, die eigenen Überzeugungen und Grenzen zu überschreiten“, hatte mich soviel Kraft gekostet.
Nun beschloss ich, noch intensive zehn Minuten mit der Erforschung meines Lagesinns zu beginnen. Der Lagesinn oder auch die Tiefensensibilität meines Körpers war ein äußerst spannendes Feld für mich. Der Lagesinn lieferte Informationen über die Position des Körpers im Raum und die Stellung der Gelenke und des Kopfes. Dieser Sinn schien bei mir nicht gut zu funktionieren, was auch laut Schulmedizin symptomatisch für meine Erkrankung war. Meine Frage, die auch meinen Erforschungen zugrunde liegen sollte, war, ob sich der Lagesinn durch gesteigerte Bewusstheit, also erhöhte Konzentration verfeinern ließe. Ich stellte mir das etwa so vor, dass der dafür zuständige Teil des Gehirns durch Informationen, die sich aus der Messung des Spannungszustands von Muskeln und Sehnen ergaben, auf die Position des Körpers im Raum schloss. Ich fragte mich, ob sich diese Gehirnfunktion, die üblicherweise automatisch und vollkommen im Unterbewusstsein ablaufen würde, durch bewusste Konzentration verbessern ließe. Vielleicht konnte ich meinem Gehirn Achtsamkeit beibringen, um diese Informationen, die schließlich Aufschluss über die Position des Körpers im Raum geben würden, klar herausfiltern und wahrnehmen zu können. Ich glaubte nicht daran, dass mein Gehirn gewissermaßen „blind“ für diese Informationen sein würde. Nicht, dass ich zu stur wäre, eine solche Einschränkung zu akzeptieren. Zwar war ich tatsächlich eine der stursten Personen auf diesem Planeten und manchmal empfand ich meine kompromisslose Sturheit als meine einzige wirkliche Behinderung, die mich oft effektgeil und unflexibel EINEN Weg einschlagen ließ. Jedoch kannte ich mich und damit die Funktionsweise meines Gehirns anhand jahrelanger Beobachtungen und Erforschungen einfach anders. Es wäre gänzlich atypisch, würde mein sonst so hypersensibles Wesen, das so schnell überreizt und überfordert war, nun plötzlich bestimmte Informationen der Außenwelt ignorieren und gar nicht erst wahrnehmen würde. Naheliegender war hingegen, dass ich nicht filtern konnte und so vor lauter Bäumen den Wald nicht sah. Ich schien etwas zu übersehen, was wichtig für meinen Körper war. Nun wollte ich all meine Aufmerksamkeit auf diesen „blinden Fleck“ meiner Wahrnehmung richten, d.h. ich musste alles ausblenden, was meinen Blick fürs Wesentliche vernebelte, und LERNEN die Informationen wahrzunehmen, die mich die Position meines Körpers würden spüren lassen. Vielleicht war es nur eine Frage der richtigen mentalen Dosierung. Ein bisschen weniger externe Trivialitäten und dagegen mehr Körper.
Mit geschlossenen Augen bewegte ich nun meine Arme im Raum und versuchte meine Aufmerksamkeit auf jede kleinste Information von der Außenwelt zu richten. Ich spürte den Widerstand der Luft, während sich meine Arme durch den Raum bewegten. Je mehr Achtsamkeit ich dem Wind schenkte, umso mehr spielte er liebevoll mit den Haaren an meinen Oberarmen. Ich konnte Gänsehaut an beiden Oberarmen wahrnehmen. Je mehr Achtsamkeit ich meinem Körper und dem Wind schenkte, umso intimer wurde das Spiel der beiden. Intimität verlangte volle Hingabe im Augenblick. Zu einer solchen konturlosen Hingabe war ich nur dann im Stande, wenn ich alle Reize drumherum ausblendete und zu einem form-und zeitlosen Niemand wurde. Ganz bewusst konzentrierte ich mich nun auf innere Bilder, die ich ursprünglich rein kognitiv entworfen hatte. Gedanken waren die Sprache des Geistes. Ich fing an, sie zu beatmen bis ich fühlte. Fühlen war die Sprache des Körpers. Mit der Atmung gelang mir die Übersetzung. Ich sah meine Knochen, Sehnen und Muskeln sowie mein tobendes, aufgepeitschtes Nervensystem. Nun schaffte ich es mit der Zeit, mein Nervensystem zu beruhigen und meine Aufmerksamkeit voll und ganz auf meine Knochen, Muskeln und Sehnen zu richten. Ich fing mit der Bewegung des Armes an und kreiste zunächst meinen Unterarm gegen meinen Oberarm. Ich versuchte mich auf die Wahrnehmung von gedehnten Sehnen, kontrahierenden Muskeln und dem Gewicht des Unterarmknochens zu konzentrieren, um auf die Haltung zu schließen. Dann öffnete ich die Augen zur visuellen Kontrolle. Realitätscheck- wie ich es nannte. Bei beiden Armen stimmte meine vorgestellte Position mit der tatsächlichen Position ziemlich überein. Auch die Arme und Finger stimmten ziemlich überein. Generell kam es auf der linken Seite hin und wieder zu minimalen Abweichungen, was nicht wirklich überraschend für mich war. Die geistige Präsenz in meiner linken Körperhälfte war auch, was Motorik, Koordination und Muskelkraft anging, schwächer als die rechte. In der Meditation konnte ich wahrnehmen, dass ich mit meinem linken Hüftknochen bereits den aufsteigenden Energiefluss aus dem linken Bein blockierte und diese Blockade durch angespannte Bauchmuskeln, die ebenfalls einen solchen freien Energiefluss verhindern wollten, verstärkt wurden. Wozu dieser Mechanismus diente und auf welches Erlebnis mein Körper so reagierte, war mir unerklärlich. Jahrelang hatte ich versucht mit verschiedenen Ansätzen analytisch ranzugehen, doch dieses Kopfzerbrechen hatte mich der Heilung nicht näher gebracht. Ich konnte im Gegenteil spüren, wie die Blockade im Zentrum sich mehr und mehr verstärkte anstatt sich aufzulösen. Mit der verkopften, analytischen Herangehensweise schien ich keine Blockaden abzubauen und etwas erneut ins Fließen zu bringen. Es war das freie Gewässer, mit dem ich arbeiten wollte. Ich wollte es stärken und toben lassen, um die starren Mauern einzureißen. Ein klarer Gedanke konnte für eine solche Naturgewalt nicht ursächlich sein. Diese Kraft konnte nur aus der Bewegung kommen. Wahrscheinlich war es nur die Wut gegen freiheitsberaubende einschränkende Kontrollen, die mich die Unterdrückung besiegen und mich frei werden ließ. Um mich für diesen bevorstehenden Kampf für die Freiheit vorzubereiten und zu stärken, musste ich meditieren. Die Forschungen zum Lagesinn konnten lediglich an der Beziehung zur Außenwelt arbeiten. Dennoch fand ich diese Vorgehensweise der Lagesinnerforschung brilliant, um von außen nach innen zu arbeiten.
Ich war mir sicher, dass es vor allem meine Beine waren, die sich im Raum nur schwer wahrnehmen konnten. In der Physiotherapie lag ich oft auf dem Rücken, während der Therapeut meine Beine und Füße durchbewegte. Meist musste ich hin und wieder meinen Kopf anheben, um feststellen zu können, ob sich meine Wahrnehmung der Position und auch der Bewegung deckten. Meist war ich überrascht nach diesem Realitätscheck, denn meine Wahrnehmung hatte mit der Realität wenig gemeinsam wie immer. In meiner Wahrnehmung befand sich beispielsweise mein Bein gestreckt und von meinem Therapeuten angehoben in der Luft, während ich beim Überprüfen feststellte, dass es komplett auf der Matte lag. Dann erst konnte ich mit Konzentration die Kontaktfläche mit der Matte wahrnehmen und so zumindest innerlich nachvollziehen, was äußerlich abging. Die Schwingungen der Realität in meinem sturen, engmaschigen Steinbock-Köpfchen auch nur im Groben zu erfassen, war eine der großen Herausforderungen meines Lebens.
Mein Blick fiel auf die Uhr. Es waren nun für diese Einheit fast zwanzig Minuten vergangen und so beschloss ich, morgen nochmals den Lagesinn zu erforschen. Dazu wollte ich auf den Boden gehen und die Position der Beine bzw. die Wahrnehmung davon im Liegen erforschen.
Da ich nun geistig sehr präsent war und bereits stark konzentriert gearbeitet hatte, begann ich ohne vorherige Meditation mit der Performance. Mein Geist war bereits geschärft sozusagen.
Nach tagelangem Hin und Her war meine Entscheidung, was die Musik anging, auf der Hinfahrt in der U8 gefallen. Ich liebte Arvo Pärt und hatte das Gefühl, dass seine Musik meinen Körper beflügelte und zu majestätischen Bewegungen inspirierte. Vor Jahren hatte ich seine Musik für eine Performance mit meiner damaligen Tanzpartnerin vorgeschlagen, die als professionelle Tänzerin und ehemalige Ballerina sehr erfahren war. Sie hatte kopfschüttelnd mit einem „der ist so ausgelutscht in der Tanzszene“ abgelehnt. Damals hatte mir dies einen Stich versetzt. Warum genau und ob es am Ende überhaupt irgendetwas mit der Musik zu tun hatte, war mir nie wirklich klar. Ich hatte mich damals jedenfalls entmündigt gefühlt. Es hatte sich angefühlt, als könne ich meine Sehnsucht nicht befriedigen wegen einer vermeintlichen Kollision mit den Bedürfnissen meiner Außenwelt. Zensur. Von außen nach innen. Zwar hatte ich damals nachgegeben, jedoch war ab diesem Tag meine unbändige Leidenschaft für Arvo Pärt entfacht. Dennoch machte seine Musik etwas mit meinem Körper und war so keine weiße Wand gewissermaßen, auf die ich mein Projekt und all seine kleinen Zwischenergebnisse projizieren könnte. Also entschied ich mich für ein Lied, das meine Freundin mir gezeigt hatte. Es war sehr zurückhaltend. Nur Percussion und kein Gesang. Die Kalimbas und Glockenspiele inspirierten meinen Körper maximal zu einer neuen Interpretation der Projektergebnisse, jedoch nahmen sie ihn nicht mit auf eine neue Reise und ließen ihn vergessen. Nach diesem Lied, das etwa 4 Minuten dauerte, wollte ich bei Stille auf den Boden heruntergehen, um dann zusammengekauert auf das nächste Lied zu warten. Für das zweite Lied hatte ich entspannende Gitarrenmusik ausgewählt. Dies war sehr untypisch, denn eigentlich würde ich die Musik als untanzbar empfinden und von der Wirkung dieser Musik auf die Tanzwelt ganz zu schweigen. Dennoch entschied ich mich dafür. Fabio hatte sie für unsere Arbeit öfter laufen lassen, was mich augenblicklich entspannt hatte. Bei der Bodenarbeit war nichts so wichtig wie Entspannung. Waren meine Beine nicht entspannt, so könnte ich sie nicht beugen, um zum Sitzen zu kommen und dann einen Schneidersitz zu bauen. Der Boden würde mir wehtun, wenn ich angespannt sein würde, anstatt mich liebevoll zu umarmen. So stand die Musik nun fest und ich konnte ordentlich proben.
Meine Assistentin hatte die Musik angemacht und ich begann mit der Performance. Gebeugt, kopfüber und ohne jede kleinste Körperspannung rollte ich zur Mitte der Bühne und begann dann langsam, mit der Melodie mich aufzurichten und quasi aus der Unterwelt aufzusteigen. Zuerst versuchten die Füße sich abzudrücken und so meine Hüfte aufzurichten. Meine Arme breiteten sich wie Flügel aus, hoben sich mehr und mehr vom Boden ab und begannen in der Luft zu tanzen, während ich noch immer kopfüber gebeugt war. Dann stützte ich mit meinem rechten Arm meinen Kopf, indem ich mit meiner rechten Hand an die Stirn fasste und so auf theatralische Art meinen Oberkörper aufrichtete. Bei dieser Aufrichtung und langsamen Überwindung der Schwerkraft durch Wechsel von der absoluten Entspannung in leichte selektive Muskelanspannung, fingen meine Muskeln und damit mein ganzer Körper an zu zittern. Dies verlieh dieser Aufrichtung noch eine gewisse Theatralik sowie eine ganz persönliche Note. Hatte ich die Zielposition sodann spielerisch erreicht, d.h. mit Rückschlägen, kleinen Stürzen und erneuter Aufrichtung, öffnete ich in voller Aufrichtung mein Herz mit ausgebreiteten, leicht flatternden Armen. Dann bekam ich das Übergewicht zur rechten Seite und ließ mich auf sehr theatralische Art und Weise aus dem Rolli fallen. Dieses Fallenlassen fiel mir schwer, da ich von maximaler Anspannung auf absolute Entspannung umschalten musste. Mein Körper schien jedoch vor dem Fallen, das mit Knieschützern, die ich dabei trug, absolut ungefährlich war, Angst zu haben und schaltete daher nur zögerlich, nicht hingegen abrupt, auf die Entspannung der Muskulatur um. Um mein Gehirn neu zu programmieren und meinen Körper schließlich neu zu konditionieren, hätte ich immer wieder nur das Fallen üben müssen. Für diese Arbeit fehlte mir jedoch die Zeit und auch die Energie. Um das Fallen immer wieder erneut üben zu können, hätte ich immer wieder mit Hilfe vom Boden auf den Rollstuhl aufsteigen müssen. Dies hätte mich sehr viel Kraft gekostet. So konzentrierte ich mich auf tiefe Bauchatmung und versuchte mit der Ausatmung einfach loszulassen und mich dem Boden hinzugeben.
Auf dem Boden wartete ich so daliegend auf das Gitarrenlied und begann mit der Impovisation. Ich hatte ein grobes Bewegungsziel (von der Rücken- zur Bauchlage, in den Vierfüßlerstand, zum Fersen- und schließlich zum Schneidersitz) und war frei, dazwischen alles so zu gestalten, wie es sich gut anfühlte. Die Musik ließ mir auch genug Zeit, die Ziele mit tiefer Bauchatmung, Spannungsbögen und Pausen, wie ich es im Projekt gelernt hatte, spielerisch anzusteuern. Der Weg war das Ziel.
Danach kam Yango vorbei. Ich zeigte ihm die Performance und bat ihn, in die Rolle eines Dramaturgen zu schlüpfen und mit wachem, kritischem Blick die Vorstellung zu genießen. Yango war berührt von dem Stück. Er machte mich darauf aufmerksam, dass ich bei der Aufrichtung noch im Rollstuhl mein Herz noch weiter öffnen und die Schultern ganz nach hinten werfen solle. Wir übten dies gemeinsam und ich war sehr froh über diesen Hinweis, denn es gab ja keine Spiegel im Studio, die mir eine visuelle Kontrolle erlaubt hätten. Was sich also für mich wie eine volle Aufrichtung und Herzöffnung anfühlte, ließ anscheinend noch immer sehr viel Luft nach oben.
Plötzlich öffnete sich die Tür und die Tänzer, die das Studio nach mir gemietet hatten, waren schon bereit. Schnell packten wir alles zusammen und verabredeten uns für die Generalprobe am nächsten Tag.
Auf der Heimfahrt war ich erschöpft, hungrig und zufrieden mit mir, meinem Freund Yango, der Performance und dem Projekt.
Am nächsten Tag fand die Generalprobe statt. Yango wollte die Lichter anbringen und die entsprechenden Stellen auf der Tanzfläche markieren, um mir die Orientierung zu erleichtern. Er hatte zwei Freunde gebeten, bei der Performance morgen zu filmen, so dass insgesamt drei Kameras während der Performance auf mich gerichtet sein würden – wie aufregend! Ich hatte den Film, den Yango während des Projektes hatte entstehen lassen, nie in seiner Endfassung ganz gesehen, wie sie morgen im Anschluss an die Performance gezeigt werden sollte. Dies lag vor allem daran, dass der Film noch nicht fertig war. Yango würde die ganze Nacht nach der Generalprobe durcharbeiten, um den Film morgen frisch aus dem Ofen präsentieren zu können. Eigentlich hatte ich damals einen Filmemacher als Mitarbeiter gewählt, um in repräsentativen Videos auf meinem Youtube-Kanal mein Projekt in kleinen Clips zu präsentieren. Leider hatte ich zwar eine genaue Vorstellung dieser Videos, jedoch war ich von dem riesigen Projekt und seinen verschiedensten Anforderungen (Organisation, Schriftführung, Tonaufnahme, Körperarbeit, Performance-Einladungen,-Sitzmöglichkeiten,-Dekoration,-Kostüm……etc.) dermaßen überwältigt, dass ich einfach nur noch die ganze Video-Arbeit vertrauend in Yangos Hände gab. Da ich ja immerhin die Texte für das Voice-over schrieb, wusste ich, dass ich im Groben mit Yangos Interpretation des Projektes zufrieden sein würde. Yango war fast jeden Tag dabei und filmte alles. Zeitlich war es ihm leider nicht möglich, noch daheim zu schneiden, um das Projekt auf meinem Youtube-Kanal so zu dokumentieren, jedoch wollte er im Anschluss an die Performance morgen einen Film zum Projekt mit vorläufigem Ende zeigen.
Nun stand ich also da mit großer Nervosität vor dem morgigen Showdown. Ich versuchte rational zu bleiben, um mich nicht in selbstkonstruierte Panik zu versetzen. Was konnte im schlimmsten Fall passieren? Also für meine körperliche Sicherheit war gesorgt, denn ich trug sowohl Knieschützer als auch ein Kissen, um meine Hüftknochen bei der Bodenarbeit zu schützen. Mein Assistent und ich hatten die Absprache, dass ich ihm ein Zeichen geben würde, sollte ich mich zu unsicher fühlen würde, alleine auf den Boden zu gehen. Er würde dann zu mir kommen und mich beim Abstieg unterstützen, was wir heute gemeinsam proben wollten. Nur für den Fall.
Der schlimmste Fall auf geistiger Ebene konnte nicht wirklich unterhalb der Gürtellinie sein, denn durch die Behinderung hatte ich sozusagen Welpenschutz. Niemand würde sich trauen, mich zu kritisieren. Mit dieser Einstellung hatte ich auch mal in meinen Zwanzigern mit meiner Freundin in einer Karaoke-Bar „Am Tag als Conny Cramer starb….“ gesungen. Meine Freundin hatte fast noch schrecklicher gesungen als ich und als Duo waren wir grausam gewesen. Dennoch hatte ich selbstbewusst unseren provokanten Auftritt im Pub genossen. Ich war mir sicher, dass niemand sich trauen würde, ein Mädchen im Rollstuhl auszubuhen. So war es damals auch und alle hatten meinen mutigen Auftritt gefeiert. Tiefer als „mutig, authentisch, inspirierend“ konnte ich also gar nicht fallen und damit war ich einverstanden.
Plötzlich kam meine Freundin Steffi mit dem Kostüm, das sie nun noch leicht abgeändert hatte, vorbei. Ich zog es mit Hilfe meiner Assistenz an und mochte es direkt. Es war genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Lila und samtig. Leggings, Rock und ein bauchfreies Oberteil mit kurzen süßen Ärmelchen. Steffi hatte mir noch zwei Flügelchen aus einem zart lila Tuch genäht, die mit drei Manschetten jeweils an einem Arm befestigt wurden. Zudem hatte sie noch kleine lila Spitzenhandschuhe genäht. Obwohl ich direkt in die Handschuhe verliebt war, wurde mir sehr schnell klar, dass ich darin nicht würde wie vorgesehen performen können. Die Bodenarbeit damit war fast unmöglich, denn die Hände rutschten nun ständig und konnten mich so nicht stützen. Auch die beiden „Flügel“ schränkten mich in meiner Performance stark ein, anstatt mich zu beflügeln. Bei der Fortbewegung blieben die beiden Tücher ständig im Rad hängen und bei der Bodenarbeit verhinderten sie auch die meisten Armbewegungen. Schweren Herzens stand mein klares „Nein“ zu diesem Accessoire für die Performance fest.
Später kam noch Stefanie Sylla, die Stimmbildnerin aus dem Team, vorbei und arrangierte die „Flügel“ am Rollstuhl, so dass sie irgendwie Teil der Performance blieben, mich jedoch nicht behinderten. Dieser Mittelweg erfreute mein Herz. Er war integer und versöhnlich. Schön und pracktisch. Herz und Verstand.
Stefanie hatte mir vor Jahren marokkanische Polster aus der Musikschule als Sitzmöglichkeiten zu meinem Geburtstag geliehen. Daran hatte ich mich erinnert und sie gefragt, ob ich mir diese für das Publikum bei meiner Performance ausleihen dürfte. Stefanie hatte eingewilligt und hatte sich für den Transport der 15,16 Sitzpolster ein Taxi zu dem Tanzstudio genommen. Ich zeigte ihr mit mehreren Unterbrechungen von verwirrten Tänzer:innen, die alle auf der Suche nach der gleichen Veranstaltung waren, während Yango mit atemberaubender Akrobatik die Lichter an der Decke anbrachte, die Performance für morgen. Sie hatte mich zum ersten Mal tanzen sehen und war beeindruckt. Als ich die Performance schließlich auf dem Boden im Schneidersitz beendete, gesellten sich nun beide zu mir. Yango hatte die Lichter für morgen angebracht und die Leiter wieder zurückgebracht. Wir besprachen, ob ich denn nun im Schneidersitz nach der Performance noch ein Lied singen oder chanten wolle. Doch ich befürchtete, nach dem Tanzen dermaßen außer Atem zu sein, dass mir sowohl Chanten, als auch ein Lied singen unmöglich sein würde. Zudem hatte ich dies noch nie öffentlich getan und würde daher Mut und sehr viel Energie brauchen. Im Gegensatz dazu war ich, was geführte Meditationen anging, sehr routiniert und erfahren. Also beschloss ich, gemeinsam mit dem Publikum zu meditieren. Sollte ich auch dafür zu sehr außer Atem sein, so wollte ich gerne Yango ein Zeichen geben und ein vorbereitetes Voice-over abspielen. Aus der Bewegung entscheiden. Yango und ich verabschiedeten Stefanie bis morgen und machten uns daran eine Chakra-Meditation aufzunehmen. Die Chakren waren mein Spezialgebiet.
Danach mussten wir zusammenräumen und das Studio für die Tänzer:innen nach uns räumen. Gestresst räumten wir alles für morgen in die Ecke(Sitzpolster, Tanzrolli, Kostüm, Knieschützer,….). Wir besprachen noch im Innenhof, wie genau das morgen ablaufen solle, da das Studio nur 90Minuten vor dem Gästeeinlass frei sein würde. Jeder Handgriff musste in dieser knappen Zeit also sitzen, um alles bewerkstelligen zu können (Beamer anbringen, Polster verteilen, Deko…) Apropos Deko, im Innenhof gab es eine sehr schöne Sitzbank, die wie geschaffen für die Performance war. Wir beschlossen sie morgen auf die Bühne zu stellen. Ich würde sie mit Blumen, Kerzen und einer Hanuman-Statue in einen Altar verwandeln. Bevor ich dann mit der Performance beginnen wolle, so würde ich erst vor dem Altar mit dem Rücken zum Publikum chanten, um mich aus der Nervosität zu holen und bei mir ankommen zu lassen. Dann verabschiedeten wir uns und umarmten uns dabei lange und innig.
Auf dem Heimweg fand ich es sehr schade, dass es keinen einzigen, ordentlichen, konzentrierten Durchgang der Performance mit Musik, Licht und Kostüm gegeben hatte. Eine solche Generalprobe hätte mir bestimmt Sicherheit gegeben und mich zumindest für heute ruhen lassen. Stattdessen hatten soviele Menschen und Details wie zB die marokkanischen Sitzpolster meine Aufmerksamkeit gestohlen. Zumindest beruhigte mich die Tatsache sehr, dass wir ein Voice-over für die Meditation aufgenommen hatten und ich so diesbezüglich auf der sicheren Seite sein würde. Nachdem wir von der U-Bahn in den Bus gewechselt hatten und uns dieser in der Nähe eines Drogeriemarktes rausließ, hetzte ich noch mit meinem Assistenten als letzte Kundin des Tages in den Laden. Ich wühlte etwas lieblos in einer großen Kiste voller Lidschattensets, die im Sonderangebot waren, und fand schließlich, wonach ich gesucht hatte. Ein Lidschattenset mit verschiedenen Violett-Tönen, passend zu meinem Elfenkostüm für morgen. An der Kasse blickte uns eine genervte Kassiererin vorwurfsvoll an und zog dann das Lidschattenset über das Band.
Zuhause angekommen bereitete ich noch alles für den nächsten Tag vor, um keine böse Überraschung erleben zu müssen. Um 14:30h sollte Gäste-Einlass sein und ab 13h das Studio für uns offen sein. Ich plante so um 11:30h da zu sein, um mich auf Toilette für die Performance vorzubereiten mit meiner Freundin Steffi, die dazu auch früher kommen wollte. Also musste ich 10:30h losfahren. Vorher ein vollwertiges Frühstück zur Stärkung und dann sollte es losgehen.
Dann atmete ich tief aus, zog meinen Schlafanzug an und schlüpfte ins Bett. Ich war froh nun heute keine Herausforderung mehr meistern zu müssen, sondern mich ins Bett legen und ruhen zu können. Mantraartig sagte ich mir auf, dass es für heute nichts mehr zu tun gäbe, bis ich schließlich einschlief.
Als am nächsten Morgen mein Wecker klingelte, war ich direkt hellwach und freute mich darauf, nun endlich das Projekt, das mich seit Monaten in Atem hielt, zu einem Abschluss bringen zu dürfen. Danach hätte ich erstmals wirklich Zeit und Ruhe, entdeckte interessante Forschungen (Lagesinn, bordering..) fortzuführen, meine tägliche Meditations- und Bewegungspraxis etwas umzustrukturieren…..einfach mal wieder als meine eigene Herrin ohne jeden Druck über meine Zeit verfügen zu können. Das sollte meine Belohnung für die heutige Herausforderung sein.
Motiviert stieg ich aus dem Bett und beschloss, ohne Nervosität jeden Zwischenschritt mit Bewusstheit und Ruhe zu würdigen, wie ich es gelernt hatte. Ich wollte immer im gegenwärtigen Moment präsent sein und versuchen im Augenblick bestmöglich zu handeln. Duschen, Frühstück, mit Knieschoner, Dekoration (Bilder, Poster, Hanumanstatue, Kerzen, Blumen) und Outfit ( Kostüm, Schmuck, Schmincke, Nagellack) pünktlich zum Bus.
Etwas mehr als eine Stunde später erreichte ich das Studio. Ich begann auf der Toilette, mit der Assistentin mich anzuziehen und mich zu schminken. Als Steffi kurze Zeit später dazustieß, lackierte sie noch meine Fingernägel, während die Nervosität stieg. Ich hatte Gänsehaut, kalte Hände und das Gefühl, mal wieder alles unterschätzt zu haben und völlig ungenügend vorbereitet zu sein. Während Yango und seine Freunde noch den Beamer und andere technische Details organisierten, half ich Steffi den Altar zu schmücken. Man konnte die Anspannung im Studio wahrnehmen. Der ausgeliehene Beamer musste ausgetauscht werden und so rannte jemand noch eben zum Austausch des Beamers und zur Ausleihe eines neuen. Währenddessen füllte sich der Innenhof mit vielen Freunden und teils bekannten Gesichtern. Dies machte mich noch nervöser, denn vor einer anonymen Masse die Hosen runterzulassen, war gar kein Problem für mich, aber vor meinen Freunden hatte ich etwas zu verlieren. Noch schlimmer wäre es, wenn meine Familie dabei wäre. Ihr Urteil konnte mir den Boden unter den Füßen wegziehen oder mich völlig losgelöst in den Himmel heben.
Ich ging noch einmal mit meinem Assistenten zur Toilette. Dann schob man mich an den Gästen vorbei in das Studio und stellte dann den Rolli vor dem „Altar“ ab. Wie geplant fing ich nun an, laut zu beten und zu chanten, während sich das Studio mehr und mehr mit Gästen füllte. Ich saß auf der Bühne mit dem Rücken zum Publikum. Meine Stimme wackelte und sprang von tief zu leise, von kraftvoll zu gehaucht, ohne jede Form der stabilen Regelung oder Dosierung. Mein Herz schien mir fast aus der Brust zu springen und anstatt, dass sich die Tonlage mit der Zeit einpendelte, wurde sie immer wackeliger und instabiler. Sie verriet meine Unsicherheit und Nervosität. Das erinnerte mich daran, dass meine Stimme mich so oft verriet und mir kein Fake oder noch nicht mal ein Pokerface erlaubte. Oft regte ich mich über etwas stark auf, wollte aber im Außen nicht zeigen, wie stark ich getriggert war und so die Coole spielen, während meine Stimme meine innere Aufgewühltheit 1:1 verriet. Manchmal setzte sie dieses Coming-out dann noch dramatischer mit Special Effects wie Atemnot in Szene und ließ mich fast hyperventilieren oder nach jeder Silbe nach Luft schnappen.
Als endlich alle Platz genommen hatten und es so still hinter meinem Rücken geworden war, beendete ich mein unsicheres, fast hysterisches Gejammer vor dem Altar, was mich sonst im Boden verankerte und erdete. Mit gefalteten Händen vor meiner Brust blickte ich zu Hanuman und bat ihn um Führung, da ich vor lauter Nervosität keine Kontrolle mehr über mich und mein System zu haben schien.
Dann rollte ich, immer noch mit dem Rücken dem Publikum zugewandt, zur Wand auf der Bühne, um dann mit Beginn der Musik, die meine Freundin auf mein Zeichen nun anmachte, kopfüber gebeugt zur ersten Lichtmarkierung zu rollen. Nun begann ich mich peu à peu aufzurichten. Endlich konnte ich diesen inneren Energieüberschuss, der mich berauscht und dabei in einen ohnmächtigen Zustand versetzt hatte, in absolute physische sowie geistige Präsenz umwandeln. Meine Bewegungen waren klar und entschlossen. Sie verfolgten das Ziel der Aufrichtung. Diese Motivation und der starke Wille meines Körpers zur Aufrichtung konnte ich in jeder Zelle meines Körpers fühlen. Die volle Aufmerksamkeit des Publikums als auch der drei auf mich gerichteten Kameras schienen meine Konzentration zu schärfen und mich in die klare Präsenz zu bringen. Im Moment der vollständigen Aufrichtung meines Oberkörpers breitete ich meine Arme aus und öffnete zitternd mein Herz. Ich spürte, dass es mich sehr viel Mut kostete, mich so offen und verletzlich zu zeigen. Meine Muskeln am Rücken, die mir die Aufrichtung meiner Wirbelsäule und schließlich meines Rumpfes ermöglichten, fingen an, zu zittern. Mein Körper fing nun an, sich zu schütteln und ich verlor das Gleichgewicht. So stürzte mein Oberkörper seitlich auf den Boden. Geistesgegenwärtig fingen mich meine Arme auf und stützten mich vom Boden ab. Nach einer kurzen Entspannung, in der ich ausatmete und alles kopfüber hängen ließ, brachte ich diese echte dramatische Szene zu einem eleganten Abschluss. Mit der nächsten Einatmung fasste ich mit meiner Hand zu meiner herabhängenden Stirn und führte so meinen Kopf nach oben, während ich meinen Oberkörper aufrichtete. Dann breitete ich meine Arme aus, zog die Schultern nach hinten und versuchte erneut, meine Brust zu öffnen und mein Herz weit zu machen. Mein Körper zitterte und wehrte sich gewissermaßen, diese aufrechte, offene Haltung einzunehmen. Ich ließ es zu und versuchte diese Zuckungen, die unglaublich spannend waren, auszuhalten. Man sah, dass sich zwei Kräfte gegenüberstanden und sich maßen. Einerseits gab es die Willenskraft, die einen kognitiv gefassten Entschluss fast mechanisch ausführte und so um die Aufrichtung und Öffnung eines verletzten, unsicheren Herzchens kämpfte, während andererseits das Bauch-Becken-Gehirn, meine Körpermitte, eine solche Haltung zu verhindern suchte und stattdessen versuchte, sich zusammenzuziehen wie eine Muschel. Dieses zitternde Kräftemessen wurde dann mit einem erneuten Gleichgewichtsverlust jäh beendet. Das Timing hätte nicht besser sein können. Mein Körper beherrschte die Choreo und mein Kopf durfte ihn vertrauend freilassen und einfach nur hin und wieder mit kleinen Akzentuierungen und Übertreibungen eine große Geschichte erzählen, die wahrscheinlich jeder im Publikum anders interpretieren würde. Nun übertrieb ich diesen Gleichgewichtsverlust, so dass ich jeden Muskel, der gegen die Schwerkraft ankämpfen wollte, entspannte und so sanft wie vorgesehen auf dem Boden landete.
Dort liegend wartete ich zusammengekauert bis das Gitarrenlied anfing. Dann rollte ich in die Rückenlage und öffnete mich langsam. Dabei half ich meinen gebeugten, angezogenen Beinen mit Nachdruck der Arme in die Streckung. Nun war wieder sowohl das Körperzentrum als auch mein Herz freigelegt. Ich spürte nun wieder meine Verletzlichkeit und die frei gewordene Körpervorderseite schien ohne die sie verdeckenden Gliedmaßen eine einzige Angriffsfläche zu sein. Es fühlte sich nun intuitiv an, mich wie vorgesehen auf den Bauch zu rollen. In dieser Bauchlage wurde ich nun mit jedem Atemzug mehr und mehr eins mit dem Boden. Mit jeder Einatmung atmete ich Kraft, Stärke und Zuversicht ein, während ich mit jeder Ausatmung eine mich schützende liebevolle Umarmung fühlte, in die ich mich hineinsinken ließ. Mein Herz schien sich dabei aufzuladen und es fühlte sich an, als würde die Vibration der Erde mein Herz schlagen lassen.
Dann begann ich die Arme aufzustützen und mich über den Boden nach vorne zu ziehen. Zu dieser Fortbewegung brauchte ich erstmals Kontur und Abgrenzung, um mich dem drohenden Stillstand durch die scheinbar alle Bedürfnisse erfüllende Umarmung der Erde widersetzen zu können. Es war nun Abenteuerlust und ein unbändiges Freiheitsgefühl, was meinen Körper motivierte, sich aus der liebevollen Umarmung zu lösen und sich und den Raum zu entdecken. Unweigerlich dachte ich an meine Pubertät.
Dann beugte ich meine Beine und stützte mein Gesäß auf meine Knie in die Luft. Meine Hände schoben meinen Körper zu meinem Gesäß nach hinten, was schließlich dazu führte, dass ich seitlich sitzend neben meinen entspannten gebeugten Beinen landete. Erneut in voller Aufrichtung, doch dieses Mal fühlte ich keine Angst. Mein Rücken fühlte sich nun entspannt und kraftvoll an und gab mir buchstäblich Rückhalt und Sicherheit, während ich mich nun aufrichtete und der Schwerkraft widersetzte.
Meine Beine waren nun auch entspannt und so leicht formbar. Ohne jeden Widerstand der Streckmuskulatur konnte ich so den Schneidersitz in Ruhe bauen. Die Gitarrenmusik erinnerte mich dabei an meine Kindheit. Mein Papa war leidenschaftlicher Hobbymusiker und wenn wir damals als Familie gemeinsam das Haus verlassen hatten, war er meist vor meiner Mutter, meinem Bruder und mir fertig. Er schnappte sich dann seine Gitarre und setzte sich auf den untersten Absatz des Wohnzimmerschranks und spielte bis alle fertig waren. Meist spielte er Pink Floyd, Simon and Garfunkel oder deutsche Songs alter Liedermacher wie Hannes Wader und Reinhard Mey. Manchmal sang er dabei auch. Er hasste es zu warten und war schon immer ein Steinbock wie aus dem Bilderbuch: ungeduldig und unflexibel. Wie ich eben auch. So ertönte öfter inbrünstig „Heute hier, morgen da“aus dem Wohnzimmer, während ich mich noch schminkte in meinem Zimmer. Solange die Gitarrenmusik zu hören war, war mein Vater entspannt und die Welt noch in Ordnung. Sobald die Gitarre im Wohnzimmer verstummte, war allen der Ernst der Lage klar und Hektik angesagt. Naja, nicht wirklich Hektik, aber Konzentration auf das Wesentliche. So hörte ich dann auf, nach etwas zu suchen und beschloss, es als unauffindbar zu betrachten, oder entschied mich das Armband mit dem komplizierten Verschluss nicht anzulegen und zur Haustür zu sprinten, um nicht die Letzte zu sein. Anscheinend hatte die Gitarrenmusik mehr als zwanzig Jahre später immer noch einen entspannenden Effekt für meinen Körper. Mit Gitarre war die Welt noch in Ordnung.
Im Schneidersitz angekommen, richtete ich mich mehrmals auf und stellte mir dabei vor, dass meine Wirbelsäule an beiden Enden in unterschiedliche Richtungen auseinandergezogen werden würde. Nach ein paar Spielereien in dieser Position und ein paar seitlichen Drehungen des Oberkörpers, verstummte die Musik. Ich schloss nun die Augen und faltete meine Hände vor der Brust.
Jetzt war die Zeit für die Meditation gekommen. Ich hatte mit Yango vereinbart, dass ich nun alle bitten würde mit geradem Rücken die Augen zu schließen und ganz im Moment anzukommen. Nach ein paar Atemzügen wollte ich dann meine Augen öffnen und Yango zuzwinkern, damit dieser das Voice-over anmachen würde.
Stattdessen flossen die Worte, die zur allgemeinen Präsenz und Verbundenheit führen sollten, nur so aus mir heraus. Mein Körper bebte und drohte zu explodieren, wenn er die ihm zuteil gewordene Aufmerksamkeit und Liebe nicht wiederum augenblicklich teilen durfte.
So begann ich, gemeinsam mit den Zuschauer:innen, eine Energiereise durch die Chakren. Ich hatte vor Jahren in Indien sogenannte „Chakra-Sounds“ gelernt, um die Wirbel auf der jeweiligen Höhe der Wirbelsäule jedes einzelnen Chakras zum Vibrieren zu bringen und die Energie in diesem Zentrum neu zu ordnen. So führte ich das Publikum durch jedes Chakra entlang der Wirbelsäule und stimmte dann jeweils den entsprechenden Sound an. Das Publikum stimmte nach kurzer Zeit ein und verstärkte meine zaghaften Töne und ließ sie sicher und voll werden. Dies trieb mir die Tränen in die Augen, denn ich fühlte soviel Liebe, harmonische Verbundenheit und kraftvolle Präsenz. Nie zuvor hatte ich eine derart starke synergetische Erfahrung machen dürfen. Es war ein schönes Gefühl, die Ursache für einen so intensiven Moment zu sein. Bei der gemeinsamen Öffnung des Herzchakras konnte ich die Intensität der Energie kaum aushalten. Nicht nur die Wirbel auf der Höhe des Herzchakras vibrierten, sondern es schien, als würde jede einzelne Zelle um mein Herz vibrieren. Ich fing an, mich so stark zu schütteln, dass ich meine vor der Brust gefalteten Hände auf dem Boden abstützen musste, um meinen Oberkörper zu stabilisieren.
Als ich nach der Chakra-Reise lächelnd meine Augen öffnete, ließ ich meinen Blick durch das Publikum schweifen. Alle hatten noch ihre Augen geschlossen und spürten dem Moment nach. Ich genoss es, das Publikum jetzt beobachten zu können in friedlicher Atmosphäre. Ruhig und zufrieden. Innen war Außen geworden. Ich schloss wieder meine Augen, um den Moment zu genießen. Nach ein paar Atemzügen in dieser Glückseligkeit öffnete ich meine Augen und gab meinem Assistenten ein Zeichen, mir nun wieder auf den Rollstuhl zu helfen. Mit tosendem Applaus machte ich die Bühne frei für die Filmvorführung und suchte mir einen Platz im Publikum.
Yango erlebte während des Projektes meinen Alltag mit wie zum Beispiel viermal wöchentliche Physiotherapie, Lauftraining, Yoga-Unterricht, so dass sich Yangos Film sich nicht, wie ursprünglich geplant, auf mein Projekt beschränkte, sondern stattdessen meine Person portraitierte. Mutig, authentisch, inspirierend. Wie immer. Es war schwer, als Künstlerin mit Behinderung gehört zu werden, wenn du noch was anderes zu sagen hast außer deiner Behinderung. Fast täglich begegnete mir diese latente Form der Diskriminierung. Fast niemand schien sich für meine Texte zu interessieren und für das, was ich in meiner Kunst ausdrücken wollte, jenseits von Behinderung. Alles schien in Relation zu meiner körperlichen Behinderung zu stehen und so nicht nur meinen Körper, sondern auch meinen Geist einzuschränken. Wenn ich meine Kunstprojekte inhaltlich auch nur ansatzweise erklären wollte, schlossen fast alle meine Worte, die soviel mehr ausdrücken wollten, als meine Behinderung, kopfschüttelnd mit einem: „Das find ich ganz toll, was du alles machst! Da könnte sich so manch einer ne Scheibe von abschneiden!“ ab. Wer ist bitte „so manch einer“? Jemand, dem das Universum nicht ganz so hart auf die Nase geschissen hat wie mir? Und ne „Scheibe von abschneiden“? Als wäre meine Kunst reiner Zweckaktionismus und mit Korbflechten für die Feinmotorik vergleichbar. Gleichzeitig wurde meine Wut, die sich in meinem Bauch bei einer solchen Bemerkung sammelte, durch das Gefühl, Verantwortung für eine ignorante Gesellschaft tragen zu müssen, geblockt. So schrie ich niemand an oder gab meiner Wut irgendwie Raum, sondern lächelte, bedankte mich und erfüllte stillschweigend meinen pädagogischen Auftrag.
Es hatte lange gebraucht bis ich mich traute, von mir als Tänzerin oder Künstlerin zu reden. Ich glaubte an mich und meine Kunst und wenn manchmal Zweifel aufkamen, so musste ich mich in Isolation zurückziehen, um mich nicht als Verräterin meiner Seele zu empfinden, die sich als naiver Fußabtreter für eine, sich für privilegiert haltende Gesellschaft aufopferte.
So war der Film ehrlich, intim, liebevoll und mit emotionalen, ausdrucksstarken Momenten. Er beleuchtete die Beziehungen zu meinen Mitarbeitern, meine Lebenseinstellung, meine Motivation und Resilienz. Was jedoch gänzlich fehlte, war meine Kunst. Es gab keinerlei künstlerische Interpretation von mir und so sah es aus, als hätte ich in meinem geförderten Kunstprojekt eine achtwöchige Behandlung über mich ergehen lassen in starrer Passivität.
Ich würde aber lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich diesen schweren Mangel des Films direkt festgestellt hätte. Ein größtenteils normatives Publikum feierte mich und Yango und einen schönen gemeinsamen Moment der Lebendigkeit in einer Feedback- und Fragerunde im Anschluss. Bis auf eine Frage war das Feedback sehr schmeichelhaft. Eine Tänzerin mit Behinderung fragte mich, wer den Spaß denn finanziert hätte. Meine Kunst als Spaß zu bezeichnen und dabei meine Arbeit sowie meinen Stress, den ich bereits in der Vorbereitung drei Monate zuvor gehabt hatte, zu leugnen, verletzte mich sehr. Dennoch nahm ich dies nicht zu persönlich, sondern fühlte darin soviel Verbitterung und Neid. Ich hatte solche Verletzungen von anderen Frauen mit Behinderung in meinen Yogakursen oder –workshops erlebt. Einmal hatte ich in einem Workshop für Frauen mit Behinderung einen Film gezeigt, den ich mit meinem Exmann zusammen gemacht hatte und der auch Indien, das Ashram und die Yogis dort zeigte. „Sirenita“dokumentierte meine damalige Gesamtsituation zwischen Yoga und Jura oder Körper und Geist. Der Film war sehr intim und zeigte auch Aufnahmen mit meiner Familie und meine Verletzlichkeit. Ich wollte das Seminar so einstimmen, um mich vorzustellen, als auch die Frauen zu ermutigen auf ihre Herzensstimme zu hören, um ihre eigene Realität erschaffen zu können. Eine Frau meinte dann nach zehn Minuten, in denen sie genervt hin und wieder laut geseufzt hatte: „Wie lange geht denn dieser Familienfilm noch?“ Aua. Das tat weh. Nach demokratischer Abstimmung beschlossen wir, den Film zu unterbrechen und lieber Yoga zu machen. Das war wohl meine erste Lektion, die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Weitere sollten folgen.
Ich erinnere mich daran, wie ich nach dem frustrierenden Workshop heulend und schluchzend im Dunkeln in meiner Küche saß. Ich fühlte mich, als hätte ich mein Herz auf die Schlachtbank gebracht, um es hungrigen, undankbaren Zombies, die längst ihre Verbindung verloren hatten, zum Fraß vorzuschmeißen. War mein Job in diesem Leben, mich für die Liebe bedingungslos aufzuopfern? Alles zu geben, was ich zu geben hatte gegen manchmal eben auch Schmerz und Leere? Konnte ich mich nicht schützen und musste lernen es auszuhalten?
Nun, jetzt mehr als zehn Jahre später, schmerzte mich diese Bemerkung, die mich und meine Arbeit völlig verkannte, noch immer sehr, jedoch schaffte ich es, sie loszulassen und auszuatmen.
Nachdem wir das Studio aufgeräumt hatten, aßen wir noch gemeinsam mit meinen und Yangos Freunden, von denen uns die meisten tatkräftig unterstützt hatten, in einem Restaurant neben dem Studio. Ich war sehr erschöpft und fühlte mich restlos ausgeleert. Hungrig aß ich meine Pizza in herzlicher Atmosphäre.
Ein Freund von mir brachte Stefanies Polster mit seinem Bus nach Hause und ich machte mich mit meiner Assistenz und einer Freundin, die beide voll bepackt waren, auf den Nachhauseweg.
Die Förderer:Innen, die bei dem Showing auch anwesend gewesen waren, wollten mit mir nochmal telefonieren, um mir Feedback zu geben. Wochen später (etwas verzögert wegen dem ersten Lock-down) machten sie mich darauf aufmerksam, dass der Film behindertenpolitisch ein No-Go sei, denn er bediene alle Klischees normativer Menschen. Er zeige eine Frau mit Behinderung, die auf der Suche nach Heilung sei. Dies bestätige eine Opferrolle, die Menschen mit Behinderung von der normativen Gesellschaft zugedacht werde. Der Film zeige mich beim Laufenüben ohne persönliche Stellungnahme und suggeriere so dem Zuschauer, dass ein Mensch, der körperlich eingeschränkt ist, noch nicht vollkommen ist. Dies sei Ableismus vom Allerfeinsten. Die künstlerische Förderung hätte mich dabei unterstützen sollen, mich als Künstlerin zu präsentieren, und zwar genau so, wie ich war. Nicht auf einem Weg zur Künstlerin oder körperlichen Heilung.
Zu meiner Performance hatte man in dem 90-minütigen Telefonat kein Wort verloren.
Nach dem Telefonat rief ich laut schluchzend Yango an. Wir reagierten beide mit Trotz und Unverständnis. „Und wenn ich fliegen will, dann will ich eben fliegen! Ich lasse mich doch nicht zensieren von diesem blöden Ableismus!“
Heute, etwas mehr als ein Jahr später, bin ich für dieses Feedback der Förderer sehr dankbar, denn es war für meine Arbeit richtungsweisend. Seitdem arbeite ich an der Klarheit und Verfeinerung meines künstlerischen Ausdrucks. Was wirklich ist meine Kunst? Meine optimistische Vorbereitung auf ein zukünftiges Ereignis? Es muss etwas im gegenwärtigen Augenblick sein. Oder ist es wirklich nur die Gabe, verschiedene Menschen und Künstler:innen zusammenzubringen und so ein magisches synergetisches Netzwerk zu schaffen? Dies wurde mir sehr oft als Kompliment gesagt und gab mir ein Gefühl, ein frisches spritziges Glas Sekt zu sein. Ich wollte nicht nur von blockierten Künstler:innen konsumiert werden und mich so nur in einer Co-Abhängigkeit wahrnehmen. Ich wollte lernen, ich zu sein, und das schien etwas zwischen Isolation und konturloser Synergie zu sein.